...und Jemen, Sudan, Kongo!? – Wahlkampf ohne globale Perspektiven

„Die Kriege und die humanitäre Lage in den Bürgerkriegsländern Jemen, Sudan und der Demokratischen Republik Kongo, aber auch der Nahostkonflikt wurde in fast allen wichtigen Wahlsendungen vollständig übergangen“, analysiert Ladislaus Ludescher von der Uni Frankfurt die Ergebnisse einer Untersuchung der Wahlsendungen zur Bundestagswahl 2025.
Die Studie zeigt, dass das Thema Migration in Zusammenhang mit innerer Sicherheit den größten Raum einnahm. Der Blick in den Globalen Süden fehlte aber (fast) völlig. Trotz fortschreitender Globalisierung in allen Bereichen wird Themen mit sogenanntem „entwicklungspolitischen“ Bezug grade einmal 0,75% der Sendezeit zuteil. „Alleine die Frage nach einem Tempolimit auf Autobahnen erhielt damit bereits mehr Sendezeit als der gesamte Globale Süden“, stellt der Wissenschaftler weiter fest. Natürlich ist Migration ein wichtiges Thema, aber die Art wie und über welche Aspekte berichtet wird ist problematisch: Warum diskutieren wir nicht über Fluchtgründe, die allzu häufig durch unsere Lebensweisen im Globalen Norden mindestens mitverantwortet wurden und werden? Auch sollten historische Zusammenhänge mehr zur Sprache kommen: Imperialismus, Kolonialismus und Co haben in all ihren Formen die Welt zu dem gemacht, was sie heute ist. In Medien und Gesellschaft kommt dies jedoch kaum zur Sprache: „Aus vielen Ländern gibt es nur eine Handvoll Berichte, und diese entsprechen oft dem Typ des opulenten Bilderbogens wie »Mit dem Zug durch Kamerun«.“, kritisiert Medienwissenschaftler Hermann Rotermund im Exposé „Was erfahren wir über den Globalen Süden?“
Die Sendungen zur Bundestagswahl 2025 haben hohe Einschaltquoten erzielt – ein Indiz für das breite Interesse an Politik und dem aktuellen Weltgeschehen. Auch die Wahlbeteiligung war die höchste seit der Wiedervereinigung. Medien und Politik tragen dabei eine enorme Verantwortung und sollten dieses Interesse nutzen, um eine gerechte, ausgewogene und tiefgehende Berichterstattung zu liefern. Anstatt Diskussionen zu polarisieren und Rechtsextremisten eine Plattform zu bieten, sollten sie zu einem breiten und vielfältigen Dialog anregen.
Zu einem solchen lädt die Veranstaltung „Pluriversum - Stimmen aus aller Welt - Diskurse für eine gerechte Zukunft“ ein. Am 31. März können Interessierte in der musa an dem außergewöhnlichen Event teilnehmen und inspirierende Impulse für lokale und globale Gerechtigkeit mit bewegender Musik und faszinierenden Video-Projektionen erleben. Wer dazu noch selbst tätig werden will, kann beispielsweise über die „Partnerschaft für Demokratie“ einen Förderantrag stellen: Jugendgruppen, Vereine, Initiativen und andere Zusammenschlüsse sind eingeladen, zu Themen rund um Demokratie, Toleranz und Beteiligung Anträge für Projekte einzureichen.
Viel Erfolg bei jedwedem Engagement für eine faire Repräsentation in Medien und Gesellschaft!
Anna-Sophie Ohlwein und das EPIZ-Team
Rechte Menschen und das (fehlende) Recht, Rechte zu haben

„Wenn Menschen Jahrhunderte lang immer wieder entrechtet und diskriminiert werden und ihre Mühen, sich aktiv an Prozessen für Demokratie einzusetzen, mit Freiheitsentzug und Menschenrechtsverletzungen bestraft werden, bedarf es einer besonderen Sensibilität im Umgang mit ihnen und mit Themen, die diese Menschen betreffen und bewegen”, schreibt Leyla Boran über die historische und systematische Diskriminierung von Ezid*innen in Deutschland und weltweit.
Diskriminierungskritische Stimmen wie Boran sprechen von demokratischer Teilhabe als einem Grundrecht, das sich aus den universellen Prinzipien der Menschenrechte ergibt. Demokratie fordert die Beteiligung aller, auch und insbesondere marginalisierter Gruppen, an Entscheidungsprozessen, die sich oft nachteilig auf ihr Leben auswirken. Extremistische Gruppen und Politiker*innen, die den Entzug der Grundrechte von Migrant*innen, Nachkommen von Migrant*innen und anderen Minderheiten fordern, richten sich gegen diese Prinzipien. Ihre „Ideologie der Ungleichheit“ betrachtet die homogene (nationale) Gemeinschaft als überlegen gegenüber Interessenvielfalt, Minderheitenschutz, Kontrolle staatlichen Handelns und Ansprüchen auf grundlegende Menschenrechte. In Deutschland und weltweit definiert die „neue“ Rechte Demokratie zunehmend im Sinne mehrheitlicher Agenden. Sie nutzen beispielsweise Online-Plattformen, um Hassbotschaften zu verbreiten und gezielt gegen Migrant*innen zu provozieren. Besonders Kinder und Jugendliche, die in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie soziale Medien nutzen, sind nachweislich das Ziel solcher Botschaften.
In Deutschland, wo über 14 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft leben, sind die Beschränkungen für Migrant*innen, die seit Jahren hier leben oder hier geboren wurden und ständig von Abschiebung bedroht sind, eine Verletzung ihres Rechts auf demokratische Teilhabe. Laut dem EU-geförderten Migrant Integration Policy Index (MIPEX) bietet Deutschland Einwander*innen zwar grundlegende Rechte und Chancen, aber keine sichere Zukunft. Das fehlende Wahlrecht für Menschen ohne Staatsbürgerschaft ist ein Beispiel für die eingeschränkten Möglichkeiten, die Politik zu gestalten, die sie betrifft.
Kampagnen für eine verstärkte Einbürgerung von Menschen oder anderer Partizipationsmöglichkeiten für alle, die in Deutschland leben, wie die von „Passt uns allen“, sind daher wichtig. Den Botschaften, beispielsweise der „Querdenken“-Demonstrant*innen in Göttingen im Februar, die als demokratisch und im Namen der Freiheit getarnt sind, muss Widerstand geleistet werden. Es sollte selbstverständlich sein, dass alle wählen, alle Rechte wahrnehmen und an allen demokratischen Prozessen teilhaben können, welche sie betreffen – wir brauchen ein modernes, zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht!
Weitreichende Teilhabe und Gestaltungsräume wünschen sich: Aarthi Murali und das EPIZ-Team
Entwickeln – aber was, wo und wohin? Die „Inneren Entwicklungsziele“
„Wenn die Ozeane kochen und die Hurrikane heftig gegen unsere einst sicheren Küsten schlagen [...] und unsere Fäuste gegen die Verweigerung der Klimagerechtigkeit protestieren: […] Es gibt Dinge, die wir tun müssen, Sprüche, die wir sagen müssen, Gedanken, die wir denken müssen.“ Mit diesen Worten weist der „wandernde“ Wissenschaftler Bayo Akomolafe darauf hin, dass wir als Einzelne, aber auch kollektiv als (Welt-)Gesellschaft unseren Blick viel öfter nach innen richten müssen
Dabei können wir von der wissenschaftlichen Erkenntnis ausgehen, dass wir in unseren inneren Haltungen viel stärker von außen beeinflusst werden, als wir selbst meist wahrnehmen. Das ist fatal, denn wenn wir uns selbst nicht gut (genug) kennen ist es schwer Veränderungsprozesse zuzulassen, die tiefgehend und nachhaltig sind. Die Organisation hinter den „Inneren Entwicklungszielen“ beschreibt dies treffend: „Ohne eine radikale Veränderung in der Struktur unserer inneren Welt können wir keine ebenso radikale Veränderung in unserer äußeren Welt herbeiführen.“
Viele sehen die „Inner Development Goals“ (IDG) als goldenen Weg hin zu sozial ökologischer Transformation oder zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDG). Sie versprechen das Erlernen von transformativen Fähigkeiten, die als Schlüssel für den erhofften großen Wandel gelten:
Wenn wir der Überzeugung sind, dass wir schon vieles wissen, ist es sehr schwierig sich darauf einzulassen, weiteres zu lernen oder auch Geglaubtes wieder zu verlernen. Genau das ist aber in der Überzeugung vieler (prominenter) Unterstützenden der IDG nötig: Wir müssen mehr und deutlicher zuhören, unsere erlernten Glaubenssätze hinterfragen sowie gewohnte Denk- und Verhaltensmuster ändern. Ein Beispiel dafür ist die meist tief verankerte Überzeugung, dass Wachstum stets erstrebenswert sei oder auch, dass es eine Fernreise braucht, um was Spannendes zu erleben.
Über derlei und noch viel mehr lässt sich unter anderem von April bis Juni 2025 im „Mitmachraum mira!“ reflektieren: Zusammen mit dem KAZ lädt das EPIZ - wie schon von August bis Oktober 2024 - zu kostenlosen, bunten und kreativen Mitmachaktionen rund um die 17 SDG und die 5 IDG ein. Du willst dabei sein und eine Aktion im mira durchführen? Dann melde dich!
„Möge dieses Jahrzehnt mehr als nur Lösungen bringen, mehr als nur eine Zukunft - möge es Worte bringen, die wir noch nicht kennen, und Zeitlichkeiten, die wir noch nicht bewohnt haben.“ (Bayo Akomolafe)
Haben dem nichts mehr hinzuzufügen: Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Heilung und Wiederaufbau: Große Herausforderungen für Syrien und die Welt

„Wir wissen nicht, was nach dem Diktator kommt. Unsere Arbeit geht erst richtig los. Grade jetzt braucht es eine starke syrische Zivilgesellschaft.“ Diese Worte prangen auf der Startseite der deutsch-syrischen Solidaritäts- & Menschenrechtsorganisation „adopt a revolution“.
Die syrische Revolution begann 2011 in der Stadt Daraa, als Kinder Graffiti an Wände sprühten, auf denen sie Freiheit und das Ende der jahrzehntelangen Diktatur von Bashar al-Assad forderten. Das Regime reagierte brutal, verhaftete und folterte die Kinder, was landesweite Proteste auslöste. Diese wuchsen schnell zu einer breiten Bewegung, die nach demokratischen Reformen und der Befreiung von politischen Gefangenen rief. Sicherheitskräfte setzten scharfe Munition ein, um Demonstrant*innen zu zerstreuen. Zahlreiche Zivilist*innen wurden getötet, verletzt oder verhaftet. Infolgedessen schlossen sich vormals Regime-treue Soldaten der Freien Syrischen Armee (FSA) an. Zusammen mit Zivilist*innen wollten sie die Bevölkerung vor der Brutalität des Regimes schützen.
Im weiteren Verlauf des Konflikts unterstützten auch internationale Mächte wie Iran, Hisbollah und Russland das Assad-Regime mit Waffen, Truppen und militärischer Hilfe. Diese Unterstützung half dem Regime, die Kontrolle über wichtige Gebiete zu behalten. Die russische Luftwaffe spielte insbesondere ab 2015 eine Schlüsselrolle, indem sie strategische Städte wie Aleppo zurückeroberte.
Syrien erlebte eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der modernen Geschichte: Knapp eine Millionen Menschen verloren ihr Leben und es gab massive Fluchtbewegungen mit über 6 Millionen Binnenvertriebenen und mehr als 5 Millionen Geflüchteten, die hauptsächlich in benachbarte Länder wie die Türkei, Libanon, Jordanien und Irak flohen.
Im Jahr 2024 gelang es der Opposition Syrien zurückzuerobern. Ein symbolischer Moment war die Befreiung der Gefangenen aus den berüchtigten Gefängnissen des Regimes, wie dem Sednaya-Gefängnis, in dem Tausende von politischen Gefangenen brutal gefoltert und viele ohne Prozess getötet wurden. Von den rund 200.000 Gefangenen, die während des Konflikts inhaftiert waren, konnten jedoch nur etwa 10.000 befreit werden. Zahlreiche Massengräber und Leichname wurden in Krankenhäusern wie in Harasta entdeckt, die das Ausmaß der Gräueltaten belegen. Das Schicksal der vielen Vermissten bleibt ein ungelöstes Problem: Viele Familien fragen sich, was mit ihren Angehörigen passiert ist
Das Land steht vor der gewaltigen Herausforderung des Wiederaufbaus und muss eine politische Lösung finden, die für alle ethnischen und religiösen Gruppen gerecht ist. Es ist ein langwieriger Prozess der Heilung und des Wiederaufbaus, der sowohl materielle als auch psychische Erschütterungen bewältigen muss. Wir begleiten den Prozess, unter anderem mit der Ausstellung „Syrien: Stimmen aus der Dunkelheit“, welche vom 28.1. bis 6.2. im Foyer des Neuen Rathauses zu sehen sein wird.
Für heute lässt sich feststellen: Die syrische Revolution hat gesiegt.
Einen hoffnungsvollen Januar wünschen Joudi Haj Sattouf und das EPIZ-Team
Spürst du Gretas Angst auch? Emotionen in der Klimakrise
„Die physischen und psychischen Folgen von Extremwetterereignissen, Hitze, Luftverschmutzung und Verlust von Biodiversität sind untrennbar verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.“ Das schreibt die Ärztin Laura Jung, die sich insbesondere im Bereich Klimagesundheit engagiert.
In den letzten Monaten lasen wir viel zu den Überschwemmungen in Spanien und die 29. Weltklimakonferenz, die im November in Baku stattfand. Zwei Wochen lang haben 197 Länder und mehr als 33.000 Menschen über die Klimakrise, Klimaschutz und die internationale Klimafinanzierung beraten. Auch die Nachricht, dass dieses Jahr erstmals weltweit im Schnitt die Temperatur von 1,5° überschritten wurde, ist - obwohl absehbar - nicht gerade beruhigend. Vor 4 Jahren trat Greta Thunberg den Teilnehmenden des Weltwirtschaftsforums mit den Worten entgegen: "Ich will, dass ihr in Panik geratet. Dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre." Dass diese Angst viele (besonders junge Menschen) spüren, spiegelt sich in einigen Studien und Umfragen wider. Reden über Gefühle ist nicht leicht, wird aber vereinfacht, wenn die Gefühle Namen haben.
Für die Gefühle bezogen auf die Klimakrise existieren einige Begriffe: Die Klimaangst ist wahrscheinlich der Popstar unter den Klimagefühlen, wie die Psychologin und Mitbegründerin von Psychologists For Future Lea Dohm es beschreibt. Die Angst, die auch Eco-Anxiety genannt wird, beschreibt das Gefühl das entsteht, wenn Menschen sich mit der möglichen und immer wahrscheinlicher werdenden Zukunft in der Klimakrise und all ihren Folgen beschäftigen. Ein weiterer oft diskutierter Begriff ist die Solastalgie. Von dem Philosophen Glenn Albrecht eingeführt, setzt sich der Begriff aus den Worten solace (englisch für Trost) und Nostalgie zusammen und beschreibt Gefühle wie Trauer und Kummer um den gefährdeten eigenen Lebensraum. Vor dem Hintergrund solch überwältigender Gefühle sind Angebote zur Entwicklung von Ressourcen, sich vor Stressfaktoren der Klimakrise zu schützen oder mit diesen umzugehen, von besonderer Wichtigkeit. Das Institut für Klimapsychologie widmet sich dieser Aufgabe mit Beratung, Forschung und Workshops zum Thema Klima-Resilienz, um Teilnehmer*innen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit umzugehen. Nur wenn wir psychisch stabil sind, können wir unsere Kraft nutzen, um Dinge zu verändern. Und obwohl Klimagefühle überwältigend sind, können sie auch Ansporn sein, aktiv zu werden: Eine Übersicht über Impulse für Weiterbildung und Engagement im Klimaschutz bietet beispielsweise der Klima Campus auf seiner Action Map. Dort finden sich neben vielen anderen tollen Aktivitäten auch die des Institut für allgemeine und angewandte Ökologie e.V. aus dem Landkreis Northeim.
Auch das EPIZ hat mit seinem Projekt Sustainable Jetzt und dem MIRA Räume geschaffen, um kreative nachhaltige Projekte durchzuführen. Dass diese und viele andere nötig sind haben zuletzt auch die wenig hoffnungsfrohen Nachrichten von der Weltklimakonferenz aus Baku gezeigt. Umso wichtiger sind ab und zu auch gute Nachrichten wie die der „Klimareporter“ gegen die Angst, um uns alle zu motivieren eine nachhaltige, sozial-gerechtere Welt zu gestalten.
Einen Dezember voller warmer und hoffentlich motivierender Klimagefühle wünschen
Sirba Gabbert und das Epiz-Team
Haiti zahlt bis heute einen hohen Preis für seine Freiheit – auch an uns

Die erste Schwarze Republik der Welt sei „ein Produkt der Moderne als auch eine Antwort auf diese Moderne“ sagt die führende Persönlichkeit der haitianischen Literaturszene Yanick Lahens.
Haiti und die Dominikanische Republik teilen sich die Karibikinsel Hispaniola, könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Während die Dominikanische Republik als Urlaubsziel und wirtschaftlich aufstrebendes Land bekannt ist, kämpft Haiti mit massiver Armut und politischer Instabilität. Das Land befindet sich in einer tiefen Krise, geprägt durch bürgerkriegsähnliche Zustände und zunehmende Gewalt bewaffneter Banden. Der Mangel an Lebensmitteln und Treibstoff sowie der Kollaps des Gesundheitssystems durch Cholera und COVID-19 verschärfen die Lage.
Die Krise hat ihre Wurzeln unter anderem in Haitis Kolonialvergangenheit: Ab 1697 machte Frankreich die Kolonie Saint-Domingue (heute Haiti) zu einer der Ertragreichsten der Welt - auf Kosten der versklavten Menschen, die unter brutalsten Bedingungen Zucker, Kaffee und Baumwolle produzierten. Die Ausbeutung der Arbeitskräfte und die intensive Landwirtschaft zerstörten den Boden und führten zu enormem Leid. Diese koloniale Gewalt und Zerstörung hinterließ tiefe Spuren, die das Land bis heute prägen. 1804 erlangte Haiti nach einem erfolgreichen Aufstand, der insbesondere von indigenen Frauen getragen wurde, die Unabhängigkeit. Es wurde so zur ersten schwarzen Republik und zum ersten unabhängigen Staat Lateinamerikas. Außerdem befeuerte es weltweit antikolonialen Widerstand und ist insbesondere für schwarze und feministische Befreiungstheorien eine wichtige Inspirationsquelle
100 Jahre Versklavung ließen das Land geschunden zurück. Außerdem zwang Frankreich Haiti dazu enorme Reparationen zu zahlen, die das Land wirtschaftlich ruinierten. Die Schulden belasteten Haiti so stark, dass sie erst 1947 abbezahlt waren. Dies behinderte die Entwicklung jahrzehntelang. Außerdem hatten Staaten wie die USA Vorbehalte gegen die schwarze Nation, was dazu führte, dass Haiti lange Zeit isoliert blieb - ganz im Gegenteil zur benachbarten Dominikanischen Republik.
Der Aufbau stabiler Regierungsstrukturen scheiterte nach der Unabhängigkeit aufgrund fehlender Erfahrung in Staatsführung und sozialer Organisation. Eine kleine Elite, meist Nachfahren der Kolonialherren, behielt die Macht, was zu tiefer sozialer Ungleichheit und Armut führte. Politische Instabilität, Korruption und internationale Einmischungen behinderten die Entwicklung zusätzlich. Auch die Umweltzerstörung durch Abholzung und Bodenausbeutung während der Kolonialzeit wirkt bis heute nach, da sie das Land anfällig für Naturkatastrophen macht und die wirtschaftliche Erholung erschwert. Haiti kämpft weiterhin mit den Erblasten des Kolonialismus wie Armut, Ungleichheit und Instabilität, und ringt um eine bessere Zukunft.
Wie Haiti geht es vielen ehemals kolonialisierten Gebieten: Daher sprechen Initiativen wie Göttingen Postkolonial oder auch die Gesellschaft für bedrohte Völker mit Sitz in Göttingen von kolonialen Kontinuitäten – die mehr in den Fokus der Öffentlichkeit müssen.
Einen kolonialismuskritischen November wünschen
Marie Vox und das EPIZ-Team
Die Rückkehr des Faschismus in der Maske der Demokratie?

"Es ist leichter, Menschen durch die schrittweise Beschneidung ihrer Rechte zu unterwerfen, als durch offenen Zwang”
Diese Worte des französischen Politikers Alexis de Tocqueville stammen von 1831, haben ihre Aktualität aber fast 200 Jahre später nicht verloren.
Seine Beobachtung bezieht sich auf einen Prozess, der im Allgemeinen als Autokratisierung bezeichnet wird, also den Rückgang demokratischer Strukturen zugunsten autoritärer Regime. Hierbei werden wichtige demokratische Institutionen und Werte geschwächt, zum Beispiel in Form von Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, Manipulation von Wahlen oder dem Unterdrücken der politischen Opposition.
Weltweit und insbesondere auch in Europa lassen sich einige politische Entwicklungen beobachten, die auf autokratische Tendenzen hinweisen. In Ungarn, Italien, den Niederlanden und Polen erfahren populistische und rechte Parteien viel Zuspruch. Sie sprechen sich gegen Migration und Geflüchtete aus, aber auch die EU und ihre demokratischen Grundwerte werden offen kritisiert. Auch bei uns in Deutschland zeigten nicht zuletzt die Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern einen ähnlichen Trend. Das alles löst allzu oft Angst vor einem allgemeinen Umschwung aus. Doch wie steht es um die Demokratie auf der Welt eigentlich wirklich im historischen Vergleich?
2023 war das durchschnittliche globale Demokratieniveau auf dem Stand von 1985. 71% der Weltbevölkerung lebte unter autokratischen Regimen. Das liegt unter anderem daran, dass viele autokratischer werdende Länder sehr bevölkerungsreich sind, wie zum Beispiel Russland, Türkei, Indonesien, Myanmar, Mexiko, Pakistan, die Philippinen und Südkorea. Die aktuell demokratischer werdenden Länder sind hingegen oft kleiner in Bezug auf Größe, Wirtschaft und Bevölkerung, wie zum Beispiel Gambia, die Malediven und die Seychellen.
Auch wenn der aktuelle Autokratisierungstrend ernst zu nehmen ist, so besteht doch Hoffnung: Zum einen zeigen aktuelle Studien, dass Regimewechsel seltener gewaltvoll und innerhalb kurzer Zeit passieren. Heute ist Autokratisierung eher ein schrittweiser, schleichender Prozess: Heimliche Gesetzesänderungen lösen Militärputsche ab. Autokratisierende Staaten bleiben dadurch immerhin länger demokratischer als ihre Vorgänger. Zum anderen kommt hinzu, dass die Zahl der sich autokratisierenden Staaten zuletzt leicht abgenommen hat. Das liegt unter anderem daran, dass Proteste aus der Zivilbevölkerung zugenommen haben, aber auch dass internationale Organisationen wie die EU Anstrengungen unternehmen, um effektiver gegen Autokratien vorzugehen. Ein Beispiel ist Polen, welches 2023 mit pro-europäischen Wahlergebnissen überraschte.
Wer sich für dieses Themenfeld interessiert, sei auf das Institut für Demokratieforschung der Universität Göttingen (IfDem) hingewiesen, welches hier vor Ort zu Ideologien, demokratischen Institutionen und gesellschaftlichen Konflikten forscht. Selbst aktiv werden können Engagierte unter anderem mit den „Partnerschaften für Demokratie“ (PfD) von Stadt und Landkreis Göttingen, Stadt und Landkreis Northeim sowie in Osterode. Gemeinsam mit der Kommunalpolitik werden dort lokale Handlungsstrategien und Projekte entwickelt, um Demokratie und Vielfalt zu stärken sowie Gewalt, Rechtsextremismus und anderen Formen der Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten. Das tut übrigens auch das neue Projekt „Vielfalt Lesen&Leben“, an dem das EPIZ federführend beteiligt ist ;)
Einen demokratischen Oktober wünschen
Marie Vox, Marika Wzietek und das EPIZ-Team
Wer schuldet hier wem? Und geht es überhaupt darum?

„Diejenigen, die uns Geld leihen, sind diejenigen, die uns kolonisiert haben. [...] Wenn wir unsere Schulden zurückzahlen, werden wir sterben. [...] Wir können sie nicht zurückzahlen, weil wir nicht die Mittel dazu haben und weil wir für diese Schulden nicht verantwortlich sind.“
Dies sind die berühmten Worte von Thomas Sankara, die er 1987 auf dem Gipfeltreffen der Organisation für Afrikanische Einheit sprach. Der revolutionäre Panafrikanist und ehemalige Präsident von Burkina Faso sprach über die „Schuldenkrise der Dritten Welt“ in den 1970er und 80er Jahren. Sie wurde in diesen Jahren durch eine Erhöhung der Zinssätze der US-Regierung für Schulden und den Wert des US-Dollars verschärft.
Mehr als vierzig Jahre danach sind die Länder des Globalen Süden so hoch verschuldet wie nie zuvor. Der vom Bündnis „Erlassjahr“ veröffentlichte Schuldenreport zeigt, dass bis Ende letzten Jahres 132 der 150 untersuchten Länder des Globalen Süden kritisch verschuldet sind, 24 davon sogar sehr kritisch. Allein bis 2022 stieg die Verschuldung der Niedrigeinkommensländer von 30 Prozent im Jahr 2015 auf rund 60 Prozent - die weltweite Staatsverschuldung stieg sogar auf das Fünffache des Jahres 2000. Die Covid-Pandemie, die Klima- und Nahrungsmittelkrise und der Krieg in der Ukraine werden als Gründe genannt, welche ausgebeutete Länder weiter in die Verschuldung treiben. Auffällig ist auch, dass sich immer mehr Länder bei privaten Versicherungen, Investmentfonds und Banken verschuldet haben. Ende 2022 hielten diese Unternehmen 60 Prozent aller Forderungen gegenüber öffentlichen Schuldnern im Globalen Süden.
Während die Kreditaufnahme Ländern kurzfristig hilft in Gesundheit, Klima und Bildung zu investieren, zwingen die hohen Zinssätze sie langfristig dazu, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen. Viele hochverschuldete Länder geben zwischen 20 und 40 Prozent ihrer Einnahmen allein für Zinszahlungen aus. Angesichts der Sparmaßnahmen von IWF und Weltbank und des sprunghaften Anstiegs des Anteils der öffentlichen Verschuldung zu Marktbedingungen sind radikale Veränderungen der Schuldenstrukturen und politische Maßnahmen die einzige Möglichkeit für die Länder des Globalen Süden, die Krise zu überwinden. Expert*innen, Nichtregierungsorganisationen und Entschuldungsinitiativen zeigen, dass die Regeln für verantwortungsvolle Ausgaben und Kreditaufnahme die gemeinsame Verantwortung von Schuldnern und Gläubigern für den Erfolg von Krediten widerspiegeln müssen. Im Jahr 2020 haben sich die wichtigsten Industrieländer der G20 auf Maßnahmen zur kurzfristigen Aussetzung von Rückzahlungen und zur Umstrukturierung von Hilfen geeinigt, um Insolvenzen zu verhindern. Diese Maßnahmen bieten aber keine langfristigen Lösungen und beziehen auch die multilateralen und privaten Gläubiger nicht mit ein.
Marginalisierte Gruppen sind von der Krise am stärksten betroffen. Maßnahmen, welche die Umschuldung mit Klimaschutz und den durch Klimakatastrophen verursachten Schäden im Globalen Süden verknüpfen, sind dringend erforderlich. Kampagnen wie erlassjahr.de und Debt Justice fordern faire Schuldenlösungen: Diese müssen Prozesse des Neokolonialismus beenden, welche Menschen in die Verschuldung treiben.
Einen schuldenfreien September wünschen
Aarthi Murali und das EPIZ-Team
Pazifische Inselstaaten kämpfen für uns alle

Tuvalus Außenminister Simon Kofe stellte sich 2021 demonstrativ ins Meer und übermittelte eine wichtige Botschaft: „Wir sinken, aber das tun auch alle anderen. […] Uns sind die Inseln heilig. Sie enthalten die Kraft, das Mana unserer Gesellschaft, sie waren das Zuhause unserer Vorfahren, sie sind unser Zuhause heute und wir wollen, dass sie auch in Zukunft unser Zuhause bleiben […]“
Wie Tuvalu sind viele weitere Inselstaaten weltweit von den Folgen des Klimawandels betroffen und stehen vor der Herausforderung, ihre Heimat zu verlieren, obwohl sie mit am wenigsten zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Bewohner*innen einer Insel in Panama werden wegen der drohenden Überflutung umgesiedelt. Doch in der Öffentlichkeit werden die Pazifischen Inseln kaum erwähnt. Um gegen die globale Untätigkeit vorzugehen, wurde die Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (COSIS) gegründet, welche mittlerweile aus 9 Inselstaaten besteht. Die Kommission fordert rechtlich bindende Verantwortungen für Staaten gegenüber den Folgen des Klimawandels. Diesbezüglich wurde der Internationale Seegerichtshof mit Sitz in Hamburg im Dezember 2022 von COSIS um ein Gutachten gebeten. Dieses sollte klären, ob Treibhausgasemissionen zum Anstieg des Meeresspiegel beitragen. Das Ergebnis: Den Inselstaaten wurde ein Recht auf besseren Klimaschutz zugesprochen, doch dies ist nicht bindend. COSIS hofft aber, dass Regierungen durch das Gutachten gewillter sind, gegen den Klimawandel vorzugehen.
Auch die Pacific Climate Warriors setzen sich gegen den Untergang der Pazifikinseln und für Klimaschutz ein. Die von Jugendlichen geführte Bewegung arbeitet mit lokalen Communitys zusammen, um die Stärke der Menschen und die Gefährdung der Inseln sichtbar zu machen.
Seit dem Pariser Klimaabkommen von 2016 sind Industriestaaten dazu angehalten, das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, doch auch dies ist nicht verpflichtend. Die COP 28 in Dubai im Dezember 2023 galt dabei als Hoffnungsschimmer. Doch während des Entscheids über das „Wegbewegen von den Fossilen Brennstoffen“ waren viele Vertreter*innen kleiner Inselstaaten nicht anwesend, obwohl sie besonders betroffen sind. Auch die Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen bleibt weiterhin zu gering und Aktivist*innen sagen, dass der Entscheid eher den Industrien als den Betroffenen diene. Doch die Bewohner*innen der pazifischen Inselstaaten kämpfen weiter, denn die Menschen haben eine starke soziale und kulturelle Verbundenheit zu den Inseln. Ein Verlust dieser bedeutet demnach auch ein Verlust der Kultur und der familiären Wurzeln.
Auch bei uns vor Ort machen sich Organisationen für den Klimaschutz und für Menschen weltweit stark. So zum Beispiel die Gruppe Fossil Free Niedersachsen, welche wie die Pacific Climate Wariors zu einem weltweiten Netzwerk namens 350org gehört. Genauso wie End Fossil Occupy setzen sie sich für das Ende der fossilen Wirtschaft ein und kämpfen für eine gerechtere Welt.
Einen klimagerechten Juli wünschen
Anna-Lena Middel und das EPIZ-Team
Hoffnung auf Veränderungen dank unserer Partner*innen im Globalen Süden

„Wir schaffen weltweit alternative Räume, welche die vorherrschenden Kräfte der Kontrolle und der Massenproduktion herausfordern: Das ist Hoffnung!“ Diese Worte spricht die indigene Grundschullehrerin und Aktivistin Seno Tsuhah in der empfehlenswerten Doku „Churning the Earth“. Der Film porträtiert Menschen in Indien, die sich gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen wehren. Sie schaffen beispielsweise nachhaltige Landwirtschaft, gemeinschaftlichen Ökotourismus, aktivitätsbasiertes Lernen, dezentrale Wassergewinnung sowie lokale direkte Demokratie. Den Kern bilden Werte wie Solidarität, Vielfalt, Freiheit, Eigenständigkeit und Gemeinwohl.
Diese sind bei der Bharatiya Janata Party (BJP) kaum zu finden, die bei der Anfang Juni endenden Wahl in Indien vermutlich erneut siegen wird. Die dann dritte Amtszeit von Premierminister Narendra Modi wäre ein weiteres Zeichen für das Erstarken des neoliberalen Autoritarismus in den mächtigsten Nationen der Welt, auch und insbesondere im Globalen Süden. Es ist zu befürchten, dass die BJP ihre Politik fortsetzt: Steuererleichterungen für Reiche, Privatisierung von Staatsbetrieben, Ausbau der Städte und Vorgehen gegen jede Form von Organisation, die nicht mit ihrem eigenen paramilitärischen Flügel (der Rashtriya Swayamsevak Sangh) verbunden ist.
Zu den gefährdeten Organisationen gehören viele, die seit Jahren innovative Lösungen für die Bedrohungen durch Globalisierung und Klimakatastrophe anbieten. „Moderne Entwicklung“ drängt weltweit marginalisierte Gruppen an den gesellschaftlichen Rand, wo sie ein prekäres Leben führen. Dabei können wir viel lernen von ihrem Widerstand und ihren oft äußerst nachhaltigen Lebensstilen. Auf ihren Erfolgen können wir aufbauen, um Lösungen für die Klimakatastrophen und die sozioökonomischen Ungleichheiten zu finden, die unser Leben weltweit beeinträchtigen.
Die Adivasi in den Wäldern von Aarey in Mumbai wehren sich beispielsweise beharrlich gegen die Abholzung ihres Landes für den Ausbau der U-Bahn. Der Widerstand ist für die über 10.000 Bewohner*innen der Aarey-Wälder ein Kampf um ihre Lebensgrundlage, für ihr Überleben.
In der indischen Region Zaheerabad in Telangana arbeiten mehrere Frauengruppen zusammen, um nachhaltige Lebensmittelsysteme zu fördern. Eine davon ist die Praxis des Anbaus von „unkultivierten Nahrungsmitteln“ oder essbarem „Unkraut“, das sehr nahrhaft ist und selbst unter den Bedingungen von Hungersnöten und Hitzewellen effizient angebaut werden kann. Organisationen wie die Deccan Development Society (DDS), Jagruti Mahila Sanghatan und Kalpavriksh arbeiten daran, solche Gruppen zu vernetzen, um Märkte für nachhaltig erzeugte Lebensmittel, technologische Lösungen sowie rechtliche und administrative Unterstützung zu finden.
Der Widerstand marginalisierter Gruppen in Indien gegen die Auferlegung von neoliberaler „Entwicklung“ findet in der ganzen Welt Widerhall, auch in der Wissenschaft. Das Zentrum für moderne Indienstudien an der Uni Göttingen untersucht beispielsweise die Zusammenhänge zwischen Modernität und kasten-, klassen- und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. Es unterstützt die Forschung zu Themen sozialer Gerechtigkeit. Die Gruppe Dalit Solidarity Network in Deutschland, die sich in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Organisationen für die Menschenrechte der Dalits einsetzt, ist in Niedersachsen stark vertreten. Außerdem hat der Verein Bargat seinen Sitz in Südniedersachsen und unterstützt von hier Graswurzelbewegungen in Indien.
Einen hoffungsvollen Juni voller „Aha-Momente“ wünschen
Aarthi Murali und das EPIZ-Team
Die Welt, Europa und wir: Quo vadis Globale Gerechtigkeit und EU?

„Bittersüßer roter Tropfen vom blaugelben Sternenshirt […] Haben gute Geister uns verlassen? Fallen wir, wofür wir steh'n? Wär doch geil, wenn's nicht so wär, wie geil wär's dann am Mittelmeer? Wenn das alles hier richtig wär? Warum ist dann mein Herz so schwer? [...] Unsre Werte leuchten in der Ferne hell...“ Wie die Sängerin Lary im Song „Krieger“ zum Rhythmus der Europahymne stellen auch wir uns die Frage, wohin wir mit Europa steuern. Die Wahl zum europäischen Parlament und der Wahlkampf dafür liefern neue Impulse.
Zahlreiche Umfragen prognostizieren einen gewaltigen Rechtsruck, der sich vor allem auf Vertrauensverluste gegenüber der Demokratie durch die zahlreichen Krisen und Kriege zurückführen lässt. Derartige Entwicklungen verheißen selten Gutes für (globale) Menschenrechte und betonen die Notwendigkeit für zivilgesellschaftliches Engagement. Daher setzt sich die agl, der Zusammenschluss der 16 Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland, zusammen mit dem europäischen NGO-Netzwerk CONCORD für eine deutliche Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen ein.
Diese Forderung findet sich im Positionspapier der agl zur Europawahl. Dort wird auch auf mehr Engagement bei Klimaschutz und zukunftsfähiger „Entwicklung“ sowie bei Wirtschafts-, Finanz- und Handelspolitik gedrängt. Außerdem unterstreicht das Papier die Bedeutung von Globalem Lernen für sozial-ökologische Transformationen. Ein Augenmerk wird zusätzlich auf eine menschenrechtsorientierte Migrationspolitik gelegt, die nach der Zustimmung des EU-Parlaments zum neuen Asylsystem „GEAS“ in noch weitere Ferne gerückt ist.
Gegen derartige Entwicklungen macht der Flüchtlingsrat Niedersachsen, auch in Göttingen, mobil. Unterstützt wird er dabei auch von Göttingen Postkolonial, die im vergangenen März die Bildungstage „Europa what the hell? Solidarität und Widerstand“ veranstalteten und dort insbesondere mit Blick auf die Wahl die Frage stellten: „Was können wir jetzt tun?“ Vernetzung, Sensibilisierung und gemeinsamer Aktivismus waren nur einige der gefundenen Antworten, die mit Menschen aus der OM10, vom Roma Center oder auch dem AK Asyl diskutiert wurden.
Auch Misereor und Brot für die Welt wollen bei einer Veranstaltung im Mai globale Fragen zur Europawahl diskutieren – unter anderem mit Spitzenkandidat*innen der großen Parteien. Außerdem kommen aus allen Richtungen spannende Positionspapiere: Die beiden erwähnten Institutionen setzen sich für ein „Europa der globalen Gerechtigkeit“ ein. Die Klimaallianz überschreibt ihr Papier mit „Europas Zukunft sichern“ und unterstreicht insbesondere, dass politische Entscheidungen dringend klimafördernd und global sozial sein müssen. Außerdem wenden sich zahlreiche Initiativen an potentielle AFD-Wähler*innen, wie beispielsweise „#AFDnee“: Unter dem Motto „Damit aus einem Denkzettel kein Bumerang wird“ zeigt sie faktenbasiert auf, dass Menschen, die die AfD wählen wollen, mit am stärksten unter der AfD-Politik leiden würden.
Die Vielfalt zeigt: Es braucht Engagement auf vielen Ebenen, um Europa zukunftsfähig zu machen. Im Kleinen und im Großen. In Brüssel und bei uns. Wir wollen unseren Teil dazu beizutragen. Und Du? ;)
Einen inspirierenden Mai wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Fairer Sport? Na klar! Aber für alle!?

„Wir wollen uns ungetrübt auf dieses Sportereignis freuen – es soll Fairness geben, nicht nur auf dem Fußballplatz. Es sollen faire Spiele werden. Und wir wollen auch, dass es Heimspiele für Menschenrechte werden.“ - Ambitionierte Worte von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Rahmen der Menschenrechtserklärung des Deutschen Fußball Bundes (DFB) und der Union of European Football Associations (UEFA).
Darin bekennen sich beide Verbände zu gerechten Lebens- und Arbeitsbedingungen rund um die Männer-Fußball-EM, die 2024 in Deutschland stattfinden wird. Es soll also alles anders werden als bei anderen großen Sportveranstaltungen wie in Südafrika 2010, Katar 2022 oder in Paris 2024: Immer wieder wurde über Menschenrechtsverletzungen berichtet, vor allem beim Bau von Stadien und anderer Infrastruktur.
Häufig werden große Sportevents auch dazu genutzt, das Ansehen des Veranstaltungsorts zu verbessern. Diese Strategie wird auch als „Sportwashing“ bezeichnet. Neben bekannteren Beispielen wie Saudi Arabien versucht beispielsweise der ruandische Diktator Paul Kagame durch das Straßenradrennen „Tour de Rwanda“ sein internationales Ansehen zu verbessern, indem er sich unter anderem mit bekannten Sportler*innen fotografieren lässt. Dass Kagame politische Gegner*innen verfolgen und verhaften lässt, wird dagegen verschwiegen. Verhält es sich da mit der Situation bei uns in Sachen Sportwashing nicht ähnlich? Während die Fußball-EM ein sauberes Image bekommt, enthält sich Deutschland bei der Abstimmung zum Lieferkettengesetz auf EU-Ebene.
Doch es gibt auch positive Nachrichten: Bauarbeiter*innen ohne Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis in Paris haben sich erfolgreich gegen gefährliche Arbeitsbedingungen eingesetzt. Mit der Unterstützung von Gewerkschaften streikten sie für ein Bleiberecht und Arbeitsverträge. Auch das Bündnis Sport handelt fair richtet sich in einem offenen Brief an adidas, den Hauptsponsor der diesjährigen EM. Das Bündnis fordert menschenwürdige Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter*innen, die an den Vorbereitungen und in der Lieferkette beteiligt sind. Außerdem weisen sie auf die Bedeutung effektiver Beschwerdekonzepte sowie auf ökologische Bedenken hin. Adidas wird auch vom Aktionsbündnis „The Yes Men“ kritisiert: In einer als Adidas-Show getarnten Inszenierung auf der Berliner Fashion Week warfen die Aktivist*innen Adidas vor, nichts gegen die schlechten Arbeitsbedingungen von Näher*innen in Südostasien zu tun.
Natürlich wird auch bei uns an zahlreichen Orten die EM verfolgt werden. Zum Beispiel in Göttingen im Stadion an der Speckstraße, wo wir 2021 ein Pubquiz zu Menschenrechten veranstalten durften. Diese und Aktionen/Kampagnen wie https://www.fairness-united.org/ oder die bei uns auszuleihende Ausstellung „FIT FOR FAIR - Sport trifft Fairen Handel“ die auf den Zusammenhang von Menschenrechten und Sportevents hinweisen, wünschen wir uns auch in diesem Jahr.
Ein gutes Beispiel für die Verbindung von politischem Engagement und Sport bietet auch der SC Hainberg in Göttingen. Der Verein organisierte in Kooperation mit UNICEF am 10.03. einen Spendenlauf für Kinder in Gaza und positionierte sich unter dem Motto #Sportgegenrechts für eine vielfältige und respektvolle Demokratie. Weitere Engagementmöglichkeiten bietet außerdem das Bündnis Sport handelt fair mit Workshops rund um fairen Handel und Nachhaltigkeit im Sport an.
Einen bewegten April wünschen
Magdalena Gerste, Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Eine weltoffene Gesellschaft braucht Demos – und mehr!
„Der 3. Februar war ein Flirt mit der eigenen Selbstwirksamkeit. Nun sind alle eingeladen, aus diesem Flirt eine dauerhafte Beziehung zu machen.“ So beschreibt Kai Schächtele von Brot für die Welt die Großdemonstrationen für Solidarität und gegen Hass und rechte Hetze.
Im Januar und Februar gingen Millionen Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße - auch in Südniedersachsen: In Northeim versammelten sich am 28.01. über 1000 Demonstrierende, über 2000 am 11.2. in Osterode und 12.000 Menschen kamen am 21.01. in Göttingen zusammen – viele weitere folgten. Auch wenn diese Aktionen ein starkes Zeichen gegen die menschenverachtenden Pläne von AfD und Co gesetzt haben, darf es nicht nur bei einzelnen Protesten bleiben. Stattdessen brauchen wir eine langfristige Organisation von demokratischem Widerstand und eine tiefgehende Auseinandersetzung mit rechtem Gedankengut. Denn dieses zieht sich durch alle Milieus und politischen Strömungen und lässt sich auf der ganzen Welt finden.
Zwar war auch wieder der Slogan „Internationale Solidarität!“ äußerst präsent auf den Demos, in der Realität kommt davon aber wenig an. Dies verwundert, denn eigentlich lernen wir von klein auf viel zu gelebter Solidarität - zum Beispiel bei Festen wie Sankt Martin. An diesem Tag wird in Kindergärten und Schulen gerne die Geschichte vom Wohlstand- beziehungsweise Mantelteilen mit den Armen erzählt. In der Mehrheitsgesellschaft gilt trotzdem eher das Credo des Neoliberalismus: „Jeder ist des eigenen Glückes Schmied!“ Serge Palasie sprach daher vor Kurzem bei einer Veranstaltung im kolonialismuskritischen Göttinger Stadtlabor von „ritualisierter Solidarität“.
Wie verzerrt das Selbstbild unserer Gesellschaft ist, zeigt die Wissenshaft: Studien zufolge hängen die eigenen Bildungschancen vor allem vom Vermögen und Bildungsstand der eigenen Eltern ab. Wenige der Profitierenden erkennen dies als unverdientes Privileg an. Solidarität bleibt dann häufig eine öffentlichkeitswirksame Geste. Daher wäre es wünschenswert, wenn dies mit den aktuellen Demos nicht passiert: Um einen systemischen Wandel zu erreichen, müssen die Ursachen der Probleme in den Blick genommen und langfristiges Engagement gefördert werden. Mit Sensibilisierungen können wir beispielsweise daran arbeiten, koloniale Kontinuitäten aufzudecken und heutige rassistische Einstellungen wirksam zu kritisieren. Das sollte schon in der Schule beginnen, damit neue Generationen früh lernen, gegen Menschenfeindlichkeiten und für vielfältige Lebensrealitäten einzustehen. Passendes Material dafür findet sich zum Beispiel bei den Kolleg*innen vom Eine Welt Netz NRW. Für Erwachsene gibt es dort unter anderem auch eine Ausstellung zum Ausleihen über das Thema Flucht/Migration und wie dieses ganzheitlich betrachtet werden kann. Auch Bildungsangebote des Antifaschistischen Bildungszentrums und Archivs Göttingen sowie Angebote des Stadtlabors können bei der Suche nach nachhaltigen Engagementwegen unterstützen.
Häufig ist es jedoch gar nicht so einfach, das neu Erlernte tatsächlich in Handeln umzusetzen. Diese Schwierigkeit wird auch „Mind-Behaviour-Gap“ genannt und erklärt das Problem, dass wir häufig wissen, was wir tun sollen, es aber trotzdem nicht machen. Um den Einstieg in den Aktivismus zu erleichtern, kann die aktive Mitgestaltung von Aktionen in Gruppen helfen. In Göttingen geht das beispielsweise bei End Fossil Occupy, Vereinen wie der Gesellschaft für bedrohte Völker oder in Hochschulgruppen. Gegenseitiger Austausch und Vernetzung können außerdem dabei unterstützen, neue Ideen zu entwickeln und sich über eigene Erfahrungen auszutauschen. In Göttingen geht das zum Beispiel vom 22. bis 24. März bei den Vernetzungs- und Bildungstagen “Europa What The Hell”.
Einen aktivistischen März wünschen
Magdalena Gerste, Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Februar 2024: Was ist schon „normal“, wenn wir auf die Welt schauen?
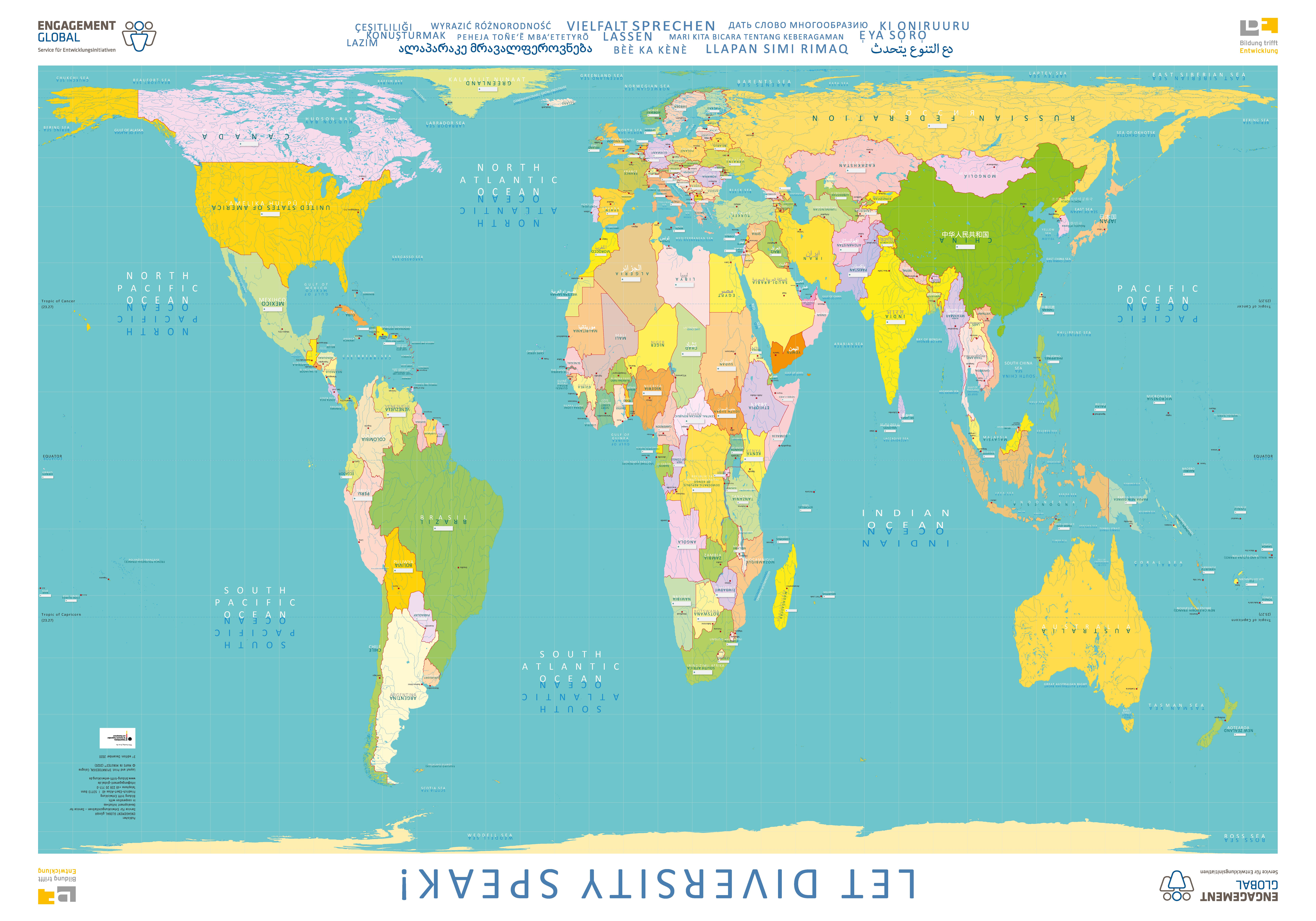
Selbstbewusst, ehrgeizig und leidenschaftlich werden Neugeborene im Jahr 2024. So die Theorie der chinesischen Tierkreiszeichen. Das Neujahr wird dort am 10. Februar gefeiert. Es ist alles andere als in Stein gemeißelt, den Beginn eines Jahres – wie im gregorianischen Kalender - am 1. Januar zu feiern.
Wie bei der Zeitrechnung gibt es auch in anderen Lebensbereichen Konzepte, die sich teils drastisch von dem unterscheiden, was wir gewohnt sind und „normal“ finden. Leider wurde diese Vielfalt insbesondere in der Kolonialzeit allzu oft unterdrückt. Kolonialmächte übertrugen die eigenen Normen auf Kolonialisierte. Dieser „,Eurozentrismus“ zeigt sich auch an der Umbenennung von Gegenden: Aus Göttingen und anderen Orten zogen Soldaten nicht nach „Namibia“, sondern nach „Deutsch-Südwestafrika“, wie es nach der Kolonialisierung genannt wurde. Daher auch der Name eines Göttinger Monuments, dessen heutige Existenz von vielen glücklicherweise nicht mehr als normal hingenommen wird.
Auch der Kontinent Abya Yala existiert für die meisten nicht mehr: Aus ihm wurde „Amerika“. Der Kontinent ist seit 20.000 Jahren besiedelt und hatte zahlreiche lokale Bezeichnungen. Trotzdem konnte er von Christopher Kolumbus 1492 „entdeckt“ und nach dem italienischen Kaufmann Amerigo Vespucci benannt werden. Die Namen waren Zeichen von Macht und Mittel der Unterdrückung sowie Kontrolle indigener Bevölkerungen. Sie trugen oft zur Vormachtstellung der Kolonialherren bei, worauf viele Beiträge hinweisen: „Wer die Karte hat, hat die Macht und wer die Karte zeichnet, macht sich das zu Nutze.“ (WDR)
Auch die Weltkarte, die Schüler*innen in Südniedersachsen und an vielen anderen Orten im Geographieunterricht kennenlernen, entspricht meist einer eurozentristischen Perspektive. Das beginnt schon bei den Größenverhältnissen: Auf der „klassischen“ Mercator-Karte erscheint Grönland genauso groß wie Afrika, obwohl Afrika in der Realität 14-mal größer ist. Eine realistischere Einschätzung der Flächenverteilung der Welt bietet die Gall-Peters-Projektion, welche unter anderem Unicef und Engagement Global (und auch wir) in großer Stückzahl verteilen.
Mit der Erkenntnis, dass Karten nur eine verzerrte Abbildung der Erde darstellen, können wir noch mehr hinterfragen: Muss Europa im Zentrum der Welt liegen? Muss der Süden unten und der Norden oben sein?
Um diverse Realitäten in Gesellschaften ernst zu nehmen, können wir uns außerdem Feiertage anschauen: Anstatt nur christliche für alle zu bestimmen, könnten neue eingeführt werden: Der Göttinger Jürgen Trittin unterstützte 2004 einen Parteikollegen bei der Forderung, einen islamischen Feiertag einzuführen. Die Stadt Göttingen gibt seit einiger Zeit einen interreligiösen Kalender heraus. Möglich sind auch mehr Feiertage ohne religiösen Bezug: Seit 2019 ist der Frauentag in Berlin für die meisten frei. Eine andere Alternative wäre, dass sich Arbeitnehmer*innen ihre Feiertage selbst aussuchen und somit ihre eigene (religiöse) Identität leben können. Die Idee des „schwimmenden Feiertags“, den Angestellte aus einer Liste von Feiertagen auswählen können, wird zum Beispiel schon von den Vereinten Nationen umgesetzt.
Es gibt aber auch weitere gute Nachrichten: So steigt bei vielen das Bewusstsein für die Problematik und es werden reihenweise Straßen und Plätze umbenannt, sowie Denkmäler gestürzt und/oder umgewidmet. Das wünschen wir uns auch für Südniedersachsen: Gerne würden wir mal am neu eingeführten „Feiertag der Menschenrechte“ durch den Bad Lauterberger Kurpark laufen, ohne von einem Kolonialverbrecher überragt zu werden – vielleicht dafür von Bhimorao Ramji Ambedkar?
Einen im positiven Sinne ungewohnten Februar wünschen
Magdalena Gerste, Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Januar 2024: Diverse Medien fördern Demokratie – in Südniedersachsen und weltweit
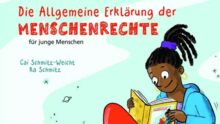
„Erst in einem Umfeld, in dem Kinder Diversitätsbücher lesen, können andere Kulturen und Menschen als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden.“ Ndey Bassine (Gründerin von AfroKids Germany)
Wir alle Wissen: Unsere Gesellschaft(en) sind divers – egal ob in Osterode, in Göttingen oder beinahe an jedem anderen Fleck der Erde. Medien sollten genau diese Vielfalt abbilden – tun dies jedoch (noch) viel zu selten. Das zeigen beispielsweise Studien zu fehlenden weiblichen Filmrollen oder generell zur Unterrepräsentation sowie negativen Darstellung von Menschen, die von Diskriminierungen betroffen sind.
Es muss also gegengesteuert werden, insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche: Erleben diese von klein auf Diversität und Vielfalt (auch) in den Medien (Bücher, Filme, Spiele etc.), entwickeln sie eine Selbstverständlichkeit für einen demokratischen und diskriminierungssensiblen Umgang in der Gesellschaft.
Ein Blick in die Auslagen von (Kindergarten-/Schul-)Bibliotheken und Buchhandlungen sowie Kinoprogrammen etc. fördert jedoch deutliches Veränderungspotenzial zu Tage – in Südniedersachsen genau wie an vielen anderen Orten. Dabei gibt es sie: Verlage, Autor*innen, Buchhändler*innen, Filmemachende und Kinobetreiber*innen, die mit viel Leidenschaft an einem gesellschaftlichen Wandel hin zu Vielfalt und Sensibilität für bestehende diskriminierende Strukturen arbeiten. Wir können uns beispielsweise glücklich schätzen, Kinderbuchhandlungen wie Winnemuth 𝖦𝖤𝖦𝖤𝖭ÜBER in Hann. Münden oder Baghira in Göttingen zu haben. Beide legen – wie auch der Buchladen Rote Straße – viel wert auf angemessene Repräsentationen. Sie bieten internationale Bücher an, stellen Thementische mit Protagonist*innen außerhalb von Rollenklischees und reproduzierten Stereotypen zusammen oder verweisen explizit auf neu angeschaffte Bücher mit queeren Charakteren – wie das Northeimer Medienzentrum. Andere, wie das Netzwerk „BIPoC-Kids Göttingen“, organisieren empowernde Veranstaltungen und tragen so zu diskriminierungsfreieren Räumen bei.
Uns fehlt neben diesen tollen Beispielen gelegentlich noch ein stärkerer Fokus auf globale Perspektiven: Diese finden sich zum Beispiel in der amnesty-Veröffentlichung "Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte für junge Menschen" oder in den nigerianischen Cartoons „Bino und Fino“, die sogar in deutsch auf Youtube zu finden sind. Auch das Kinderstark-Magazin für mehr Vielfalt wagt immer wieder den Blick über die nationalen Grenzen hinaus – genau wie der Podcast „my poc bookshelf“.
Für diese und vieles mehr würden wir sehr gerne im kommenden Jahr in Südniedersachsen mehr Aufmerksamkeit schaffen: Daher überlegen wir gemeinsam mit tollen Initiativen diverse Lesungen, Ausstellungen, Bücherkisten und mehr auf die Beine zu stellen. Wenn auch Ihr daran Interesse habt und mitwirken wollt, sprecht uns gerne zeitnah an :)
Denn auch wir wünschen uns zusammen mit Ndey Bassine eine Welt, in der „andere Kulturen und Menschen als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden.“
Einen Januar voll diverser Geschichten über Südniedersachsen und die Welt wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Dezember 2023: Wünsch Dir was – für ein solidarisches Südniedersachsen 2030

"Grundlegende Veränderungen lassen sich nicht ohne ein gewisses Maß an Verrücktheit herbeiführen. In diesem Fall kommt sie aus der Nonkonformität, dem Mut, sich von den alten Formeln abzuwenden, dem Mut, die Zukunft zu erfinden." - Diese Worte fand der revolutionäre erste Präsident Burkina Fasos, Thomas Sankara, in einem Interview 1985. Davon lassen wir uns sehr gerne inspirieren:
A m Northeimer Rathaus weht eine Regenbogenfahne. Unter ihr diskutieren queere schwarze Aktivist*innen mit der Stadtverwaltung, wie der öffentliche Raum inklusiver gestaltet werden kann. Am ehemaligen Südwestafrika-Denkmal in Göttingen feiert die Bürgermeisterin mit ihrer Amtskollegin aus Swakopmund/Namibia die neugegründete Städtepartnerschaft, in der es um die Aufarbeitung der Beziehungen zwischen ehemaligen Kolonisator*innen und Kolonialisierten geht. Und an der Polizeiakademie in Hann. Münden erläutern fahrradbegeistertete Eritreäer*innen ihren Kolleg*innen, wie das Radfahren auch hier in Südniedersachsen zum klimaschonenden Arbeitsalltag gehören kann.
Wenn wir einen Wunschzettel für die Entwicklungen bis ins Jahr 2030 schreiben dürften, dann ständen dort diese und noch viele weitere Ideen drauf. Denn dass es eine große sozial-ökologische Transformation bei uns und weltweit braucht hat, neben vielen anderen, nicht zuletzt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ mehrfach betont. Aber welche Veränderungen braucht es? Woran können wir uns orientieren? Natürlich bieten sich die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN an – aber auch die Studie zur „Globalen Bewegungslandschaft“: Sie verdeutlicht, dass es ein „Global Citizens Movement“ braucht, welches grundsätzliche Visionen und Ziele teilt und sich nicht spalten lässt. Denn dank Audre Lorde wissen wir: „Es sind nicht unsere Unterschiede, die uns trennen. Es ist unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede anzuerkennen, zu akzeptieren und zu feiern.“ Wir verstehen uns als eines der vielen nötigen Puzzleteile und formulieren daher unsere Vorstellungen von einer Welt, die sich den vielen globalen Krisen konsequent stellt und grundsätzliche Veränderungen auf den Weg bringt.
Dabei orientieren wir uns an den tollen Arbeiten unserer Kolleg*innen vom ila Kollektiv: Ausgehend von der Analyse, dass wir im Globalen Norden stark „auf Kosten anderer“ leben, formulieren sie Wege in die solidarische Lebensweise – und Strategien für radikale Transformation, welche „die Welt auf den Kopf stellen“. Prima winterliche Leselektüren übrigens!
An derlei Wegen arbeiten auch viele in Südniedersachsen: Beispielsweise „GöttingenZero“, welche die Region bis 2030 klimaneutral machen wollen und mächtig Welle für die Bürger*innenbegehren zu Verbesserungen des Fahrradverkehrs machen. Oder auch die Beteiligten am freien Theater „boat people project“, die gesellschaftspolitische Fragestellungen kunstvoll thematisieren und Impulse für einen menschlichen Umgang mit Flucht und Migration setzen. Von derlei Aktivitäten wünschen wir uns mehr – 2030, aber gerne auch schon früher :)
Einen Dezember, in dem wir es wagen Wünsche zu erfüllen, wünschen
Lisa Marie Dresbach, Chris Herrwig und das EPIZ-Team
November 2023: Ob in Nahost oder Anderswo: Gegen Entmenschlichungen in jeglichen Konflikten

Wir könnten ein Statement zur Solidarität mit den Getöteten und Verletzten durch den Terror der Hamas schreiben oder die Einbeziehung der Perspektiven von Menschen in den palästinensischen Gebieten anmahnen – im Sinne des UN-Generalsekretärs António Guterres oder wie in der kontrovers diskutierten Rede von Philosoph Slavoj Zizek bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Jedoch: Unser „Kompass“ ist das Existenzrecht aller Menschen. Daher schließen wir uns gerne der Organisation medico international an:
„Unsere Solidarität gilt in diesen Tagen mehr denn je der Zivilbevölkerung in Israel und Palästina, ihrem Wunsch und ihrem Recht auf ein Leben in Frieden und ohne Angst. Dies ist nicht die Zeit, ihr Leid auf die eine oder andere Weise zu instrumentalisieren.“
Daher schauen wir auf die zahlreichen konstruktiven und potentiell friedensstiftenden Impulse aus der Zivilgesellschaft: Im September veröffentlichten über 100 palästinensische Intellektuelle einen offenen Brief, in dem sie „jeden Versuch der Verharmlosung, Falschdarstellung oder der Rechtfertigung von Antisemitismus [...] auf das Schärfste zurückweisen“. Vor wenigen Tagen zogen über 100 in Deutschland beheimatete jüdische Kunst- und Wissenschaffende nach: Sie mahnen Frieden und Meinungsfreiheit an. Die palästinensische Friedensforscherin Dr. Zeina Barakat hat ein arabisches Lehrbuch über den Holocaust verfasst und war auch schon als Projektmitarbeiterin an der Uni Göttingen aktiv. Inzwischen bringt sie Studierende aus Israel und Palästina zusammen, die sich für gewaltfreie Konfliktlösungen einsetzen.
Derlei Projekte wirken der verbreiteten Entmenschlichung und dem selektiven Humanismus, der seit Jahrtausenden immer wieder Gruppen und Einzelpersonen das Menschensein absprechen, entgegen. Darauf weist unter anderem auch der Zeit-Journalist Andreas Backhaus hin: „Viele Menschen im Gazastreifen wollen mit dem Terror der Islamisten nichts zu tun haben; sie gründen Start-ups, betreiben nachhaltige Landwirtschaft oder spielen mit kriegsversehrten Armen oder Beinen Profifußball.“ Diese Vielfalt findet sich auch unter israelischen und jüdischen Stimmen, die selbstverständlich nicht alle rassistische Ultranationalist*innen sind: Alle haben Anspruch auf ein unversehrtes, freies und insbesondere friedliches Leben. Viele wollen genau das – gehen aber allzu oft in Diskursen unter.
Ähnliches sehen wir beispielsweise im Bezug auf russischen Widerstand gegen den aktuellen Angriffskrieg, der auch von Göttingen ausgeht. Aber auch durch die syrische Freiheitsbewegung sowie Friedensaktivist*innen aus Äthiopien, die unter anderem aus der südniedersächsischen Diaspora heraus mit Appellen und Aufrufen versuchen die Lebenssituation von Menschen in Konfliktregionen zu verbessern.
Daran anknüpfend stellen wir uns auf die Seite derer, die sich für Zusammenarbeit und Gleichberechtigung aller einsetzen, die sich konsequent gegen Rassismus, Antisemitismus und jegliche Form der Diskriminierung und Unterdrückung einsetzen. Die Empathie leben, gegenseitiges Wohlwollen propagieren und sich mit Ansätzen wie der „Gewaltfreien Kommunikation“ für Achtsamkeit und friedensstiftende Verbindungen einsetzen. Daher unterstützen wir über unseren niedersächsischen Dachverband VEN die Ausbildung von Friedensmentor*innen und verweisen gerne auf die tolle Arbeit unser Kolleg*innen von gewaltfrei handeln e.V. im nahen Diemelstadt, die unter anderem Fachkräfte für Friedensarbeit ausbilden.
„Wer sagt, man könne nicht für beide Seite gleichzeitig kämpfen, hat seine Seele verloren.“ (Slavoj Zizek)
In diesem Sinne: Einen se(e)ligen November wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Oktober 2023: „Sí“ zu einem weltweiten Paradigmenwechsel in der Klimapolitik!
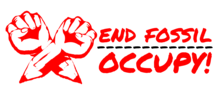
Eine deutliche Mehrheit hat für ein Ende der Förderung in einem der größten Ölfelder Ecuadors im Yasuní- Nationalpark gestimmt. Ivonne Yánez von der Umweltorganisation Acción Ecológica kommentiert das erfolgreiche Referendum rund um das Verbot der Erdölförderung im ecuadorianischen Teil des Amazonas-Regenwaldes mit enthusiastischen Worten: „Ich denke, wir sind mit dem Ergebnis in die Diskussion über das Nach-Erdöl-Zeitalter in Ecuador eingetreten. [Es hat] Effekte für die Region – und vielleicht sogar für den Rest der Welt“.
Vieles spricht dafür, dass die Entscheidung auch in den Nachbarländern Kolumbien, Brasilien oder Peru auf fruchtbaren Boden fällt: Große Teile des für den Export gedachten Erdöls könnten im für das Klima günstigsten Fall auch dort im Boden bleiben. Dies würde jedoch riesengroße Einschnitte für die Wirtschaften der Länder bedeuten, die aktuell stark von den Exportmilliarden abhängig sind. Diese sehen viele, insbesondere in den sozialen und ökologischen Bewegungen, jedoch als große Chance auf echten Wandel: Indigene setzen sich beispielsweise für die Förderung von nachhaltigem Tourismus ein. Derlei Alternativen bekommen immer mehr Aufmerksamkeit – unter Anderem, weil das erfolgreiche Referendum nur eines von zahlreichen in den letzten Jahren in Ecuador gegen Ölförderungs- und Bergbauprojekte war.
Neben Südamerika tut sich inzwischen überraschenderweise auch einiges in Nordamerika: Kalifornien verklagt beispielsweise die fünf größten Ölkonzerne der Welt: Der Bundesstaat wirft den Unternehmen vor für Umweltschäden in Milliardenhöhe verantwortlich zu sein. Außerdem sollen sie Falschinformationen über die Risiken fossiler Energieträger verbreitet haben. Die Tagesschau sieht Chancen, dass Kalifornien damit ein Exempel für viele andere weltweit setzen könnte.
Während Aktivist*innen in Ecuador „Lasst das Öl im Boden“ auf Transparenten durch die Straßen tragen und sich beim „Indigenous Women’s March“ über 5000 Teilnehmende auf den Weg in Brasilien’s Hauptstadt machen, flatterten in den vergangenen Monaten auch in Göttingen und Umgebung ähnliche Parolen an Schul- und Unifassaden: Die insbesondere jungen Engagierten von „End Fossil: Occupy!“ besetzten das Forum Wissen, Schulen und die Uni. Außerdem waren sie auch beim Klimastreik von Fridays for Future mit dabei.
Ähnlich wie die jungen Aktivist*innen setzen sich auch die Engagierten der „Gemeinwohlökonomie“ für eine Wirtschaft ein, die Lebewesen und die Natur in den Mittelpunkt stellt: Sie stellt die Werte Menschenwürde, ökologische Verantwortung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz in den Mittelpunkt. Damit stellt sie sich radikal gegen das vorherrschende Wirtschaftssystem und setzt damit auf einen ganzheitlichen und systemischen Paradigmenwechsel. In Göttingen und Umgebung sind hier beispielsweise Unternehmen wie Beckers Bester, die Stadtwerke oder Naturkost Elkershausen dabei – sowie zahlreiche weitere.
Es gibt also Hoffnung, denn es wandelt sich an vielen Ecken der Welt einiges. Daher lassen wir uns nicht entmutigen, freuen uns auf viele weitere gute Nachrichten und sind gespannt, was die im Oktober anstehenden Wahlen in Ecuador und die vielen weiteren auf der ganzen Welt mit sich bringen.
In diesem Sinne: Einen hoffnungsfrohen Oktober wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
September 2023: (Fair)teilen und zusammen nutzen: Gemeingüter weltweit und in Südniedersachsen

„Der Kapitalismus ist nicht zukunftsfähig. Wenn wir glauben, die Welt durch nachhaltigen Konsum vor der Klimakatastrophe zu retten, betrügen wir uns selbst.“ Mit diesen Worten beschreibt Prof. Kohei Saito, warum er den Wandel hin zu einem „Degrowth-Kommunismus“ für sinnvoll hält.
Aktuell bedeuten Fortschritt und Entwicklung bei uns meist Ausbeutung von Arbeitskraft und natürlichen Ressourcen – viel im Globalen Süden. Das ändert sich auch bei Ansätzen von „grünem Wachstum“ oder einem „New Green Deal“ kaum: Die Zerstörung der Lebensgrundlagen von Indigenen in Bolivien, Chile und Argentinien durch den Lithium-Abbau zur Herstellung von Elektro-Auto-Batterien ist eines von vielen Beispielen. Daher schlagen Unterstützer*innen der „Commons-Bewegung“, die sich im deutschsprachigen Raum rund um das Commons-Institut finden lässt, eine commons-basierte Gesellschaft vor: Besitz statt Eigentum und Menschen tragen bei statt zu tauschen. Bereits existierende Beispiele sind Wikipedia oder auch am Gemeinwohl orientierte Bibliotheken.
Derlei Projekte brechen konsequent aus der Logik von Märkten aus. Dies ist in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („SDGs“) bisher selten der Fall. Daher setzen sich Akteure wie das International Science Council dafür ein, dass die Transformationen im Rahmen der SDGs noch mehr commons-orientiert und partizipativ geschieht. Dazu beteiligten sie sich auch an der von der International Association for the study of commons (IASC) organisierten großen Konferenz zum Thema in Nairobi. Kohei Saito ist weniger optimistisch und beschreibt die SDGs polemisch gar als „Opium des Volkes“. Er setzt sich für Gesellschaftsmodelle ein, die ihre Wirtschaft durchgängig am Gemeinwohl orientieren. Dazu hält er die Vergesellschaftungen großer Ölkonzerne, Banken und der digitalen Infrastruktur für notwendig – sowie im Lokalen den Aufbau von solidarischen Gemeinschaften.
Davon gibt es auch in unserer Region einige Modellprojekte wie das tauschlogikfreie „Utopische Salzderhelden“, die partizipative flause oder die zahlreichen solidarischen Landwirtschaften in der Region. Auch das Mietshäuser Syndikat - mit der OM10 und dem Grünen Haus anner Ecke in Göttingen – welches Häuser in Gemeineigentum überführt, zählt dazu. Die Lebensgemeinschaft „gASTWERKe“ unterhält Verbindungen zum indischen grassroots Netzwerk Vikalp Sangam, welches sich explizit gegen das dominante Entwicklungsparadigma stellt und eines von vielen Beispielen für commons-basiertes Zusammenleben im Globalen Süden ist.
Eine Gesellschaft die auf „Commons“ basiert ist also weit davon entfernt bloß eine ferne Utopie zu sein: Dies zeigt auch der Erfolg des aktuellen Buches des erwähnten Kohei Saito, welches sich in Japan über 500.000 mal verkaufte. Die Zukunft wird zeigen, ob auch die grade erschienene deutsche Übersetzung für ähnliche Aufmerksamkeit bei uns sorgen wird ;)
Einen mit Gemeingütern reich gefüllten September wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Juli/August 2023:Mainstreaming Engagement für globale Gerechtigkeit – lokal und weltweit

München hat eins, Köln auch. Außerdem Stuttgart, Aachen, Freiburg, Bielefeld, Heidelberg und viele viele andere Städte: Eine-Welt-Zentren – Orte, an denen sich Engagierte gemeinsam für globale Gerechtigkeit einsetzen. Berlin hat gar ein ganzes „Global Village“. Und Göttingen? Hier gibt es seit einiger Zeit eine aussichtsreiche Initiative für ein Welthaus in der alten Stockleffmühle am Leinekanal.
Neben vielen Anliegen möchten die dort Engagierten Themen wie Fairer Handel, Klimagerechtigkeit oder auch Fragen um Flucht und Migration sowie Transkulturalität zu mehr Aufmerksamkeit in der Stadtgesellschaft verhelfen. In Zeiten zahlreicher globaler Krisen erscheint die Dringlichkeit dafür unbestreitbar gegeben. Daher wirkt es paradox, dass aktuell zahlreiche Initiativen kaum geeignete Arbeits-, Gruppen-, Veranstaltungs- oder Lagerräume in der Stadt zur Verfügung haben. Der viel frequentierte Weltbürger*innentreff platzt beispielsweise aus allen Nähten und im EPIZ sitzen Mitarbeitende teilweise zu zweit an einem Schreibtisch. Die dortige Bibliothek inklusive der tollen Materialien von Bildung trifft Entwicklung hat auch längst sämtliche Kapazitätsgrenzen erreicht.
Wenn wir es also ernst meinen mit Klimagerechtigkeit, den globalen Nachhaltigkeitszielen, den Menschenrechten, dem Versprechen, ein sicherer Hafen für Geflüchtete zu sein und wenn wir der Charta der Vielfalt gerecht werden wollen, dann braucht es einen Ort, an dem das dazugehörige Engagement Platz hat: In einem Welthaus wären Begegnung, Austausch, das Nutzen von Synergien, Beratungen, Informations- und Bildungsveranstaltungen sowie Kulturelles verschiedenster Art möglich.
Nicht nur Fridays for Future, sondern auch zahlreiche andere Initiativen zeigen: Insbesondere junge Menschen bei uns und überall auf der Welt suchen mehr und mehr nach Wegen, sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. Das Streben nach alternativen Lebensentwürfen abseits von (globaler) Ausbeutung von Mensch und Natur ist längst kein Nischenthema mehr. Viele Studien zeigen: Die junge Generation will
mitgestalten, allerdings weniger in Parteien sondern vermehrt punktuell und themenspezifisch. Derartiges Engagement wäre möglich in einem offenen Zentrum, welches als Plattform für demokratische Prozesse abseits von klassischer Parteipolitik fungieren könnte.
In Göttingen würde bei der Verwirklichung eines Welthauses außerdem ein altes Baudenkmal zu neuem Leben erweckt und ein attraktiver Ort in der Göttinger Innenstadt entstehen. Viele gute Gründe also, sich dafür einzusetzen. Aktuell braucht es insbesondere noch Spenden und Zustiftungen, damit die Initiative in die Zielgrade einbiegen kann.
Daher gilt im Juli/August und darüber hinaus: Stockleffmühle erhalten, Welthaus gestalten!
Chris Herrwig, Lucia von Borries und das EPIZ-Team
Juni 2023: Transnationale Solidarität von Gewerkschaften – weltweit und in Südniedersachsen?

"Es mag Zeiten geben, in denen wir machtlos sind, Ungerechtigkeit zu verhindern, aber es darf nie eine Zeit, geben, in der wir nicht protestieren." (Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel)
Zurzeit wird weltweit viel über Löhne und Gehälter verhandelt. Arbeiter*innen unterschiedlichster Branchen kämpfen unterstützt von Gewerkschaften für angemessene Arbeitsbedingungen - unter anderem mit Streiks. In der medialen Berichterstattung wird häufig jedoch als ablenkende Erzählung nur das legitime Protestmittel problematisiert und wenig die Gründe dahinter. Das verdeutlicht die vorherrschende Angst, dass organisierte Arbeiter*innen weitreichende Forderungen durchsetzen können: Es gibt zahlreiche aktuelle
Beispiele für solidarisches Handeln, aber auch für Herausforderungen und Potentiale, die Gewerkschaften in unserer globalisierten Welt haben.
Der erste Mai hat seinen Ursprung in transnationaler Arbeiter*innen-Solidarität und Selbstorganisation. Über die Jahrzehnte wurde immer wieder versucht diesen wichtigen Feiertag für Propagandazwecke zu missbrauchen. Heute können wir jedoch auf Bildern von Demonstrationen weltweit erkennen, dass der ursprüngliche Geist weiterlebt: Zahllose Gewerkschafts-Zusammenschlüsse bringen in vielen Teilen der Welt Arbeiter*innen auf die Straße. Berichte von den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich, gegen lange Arbeitstage in Südkorea, gegen die Privatisierung der Industrie in Sri Lanka, oder weltweit gegen die Inflation und für angemessene Löhne, zeigen dies deutlich.
Migrantische Arbeiter*innen in Gewerkschaften hatten es in der Vergangenheit - und haben es auch heute noch zu oft - nicht leicht: Die Spaltung zwischen nationalen Interessen und der Aufgabe Lohnabhängige jenseits von Herkunft und Aufenthaltsstatus zu unterstützen, führte immer wieder zu Brüchen und der Notwendigkeit sich selbstständig zu organisieren. Die prekären Lebensverhältnisse von migrantisierten Menschen haben einen großen Einfluss darauf, wie „erpressbar“ sie gegenüber ihren Arbeitgeber*innen sind. Arbeiter*innen ohne anerkannten Aufenthaltsstatus nehmen daher Gewerkschaften in die Pflicht, sich auch mit Einwanderungspolitik zu beschäftigen, wie Beispiele aus Deutschland und Frankreich zeigen.
Neben den selbstorganisierten Kämpfen migrantischer Arbeiter*innen gibt es aber auch vermehrt gewerkschaftliche Unterstützung: Inspirationen liefert die Initiative Migranti, die migrantische Arbeitskämpfe in Europa vernetzt. Lokal solidarisiert sich derzeit die Gewerkschaft FAU in Göttingen mit von systematischem Rassismus betroffenen Arbeiter*innen einer DHL-Filiale im Landkreis. Auch Initiativen wie die OM10 in Göttingen, die aus der Besetzung eines alten Gewerkschaftshauses entstand, zeigt, das gemeinschaftlicher Protest Erfolg haben kann.
Einen transnationalistischen Juni wünschen
Lucia von Borries und das EPIZ-Team
Mai 2023: Menschenrechte und Kolonialität – Fluch und Segen

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“
Am 10. Dezember 1948 wurde die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ verkündet. Sie feiert in diesem Jahr – auch in Göttingen – 75-jähriges Jubiläum. Schon vor diesem Datum gab es Menschenrechte in unterschiedlichen Ausführungen überall auf der Welt. In Europa wurde Menschsein ab dem
19. Jahrhundert vor allem in Abgrenzung zu Gott auf der einen und Tieren auf der anderen Seite verstanden. Nicht alle Menschen wurden dabei jedoch als solche anerkannt: Frauen, Schwarze und generell kolonisierte Menschen blieben meist außen vor. Die Definitionsmacht darüber, wer als Mensch galt, nahmen zumeist weiße Kolonisator*innen für sich in Anspruch – und damit auch die Entscheidung, wem Menschenrechte zustanden. Das vereinfachte die Legitimation kolonialer Herrschaft: Der Nobelpreisträger Robert Koch, der an der Uni Göttingen studierte und promoviert wurde, führte auf dieser Grundlage Menschenexperimente in Kolonien durch. Menschen wurden zu Ressourcen, zu Fundgruben wissenschaftlicher Erkenntnis. Dies ist unter anderem ein Ausdruck von „epistemischer Gewalt“: Jener Gewalt, die mit unserem Wissen zu tun hat.
Die Unterscheidung zwischen Menschen lässt sich auch auf die Unterscheidung zwischen Sprachen anwenden, denn auch die Linguistik ist kolonial und eurozentrisch gewachsen. Die aktuelle Sonderausstellung im Forum Wissen setzt sich mit genau dieser Problematik auseinander. Sie beschäftigt sich mit Sprachforschung während des Ersten Weltkrieges im Kriegsgefangenenlager in Göttingen und fragt, wer die Forschung auf welche Art und Weise aktiv mitgestalten konnte: Wer forschte und wer wurde untersucht? Wer produziert unser Wissen? Wie und wo wird es erzeugt, wer eignet es sich an und warum?
Dies sind auch Gedankenanstöße für die ethnologische Sammlung der Uni Göttingen: Denn auch das Sammeln und (Um-)Benennen von Objekten aus den Kolonien und deren Zurschaustellung in Europa, dem hegemonialen Zentrum, ist Ausdruck epistemischer Gewalt. Menschenrechte sind also mit Kolonialität verwoben. Sie lieferten in einigen Fällen, beispielsweise bei Robert Koch, die Grundlage für koloniale Gewalt und Ausbeutung, aber auch für antikoloniale Kämpfe und Widerstand – und können somit auch der Schlüssel für ein pluriverselles Verständnis vom Menschsein sein. Neue Sichtweisen zum Thema können zum Beispiel transkulturell auf dem weltwärts-Festival oder am African Liberation Day ausgetauscht werden – zwei Veranstaltungen, die passenderweise den Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung am 21. Mai einrahmen.
Einen inklusiven und vielfältigen Mai wünschen
Annika Bucher und das EPIZ-Team
April 2023: Mit Demut Macht umverteilen – global und lokal

„Liebevolle Demut ist eine gewaltige Macht, die stärkste von allen, und es gibt keine andere, die ihr gleichkäme.“ - Dies schreibt Dostojewski in seinem Roman „Die Brüder Karamasow“.
Im Bericht Shifting Power von VENRO werden dekoloniale Bemühungen von Organisationen in der „Eine Welt-Arbeit“ vorgestellt. Dekolonisierung bedeutet unter Anderem, Verantwortung für die Folgen des Kolonialismus zu übernehmen: Am 7. April wird beispielsweise dem Völkermord in Ruanda gedacht, dessen Ursachen auch in der Kolonisierung der Region durch Deutschland liegen.
Bei der Dekolonisierung von Organisationen geht es exemplarisch um die Verlagerung der Projektplanung und Entscheidungsfindung von Deutschland in die südlichen Partnerländer, die Vermittlung von Fachkräften aus dem Globalen Süden in das „Entwicklungsland Deutschland“ oder die Aufarbeitung vereinsinterner Rassismen: Ansätze zur Dekolonisierung gibt es also reichlich. Selten geht es aber um eine ganzheitliche Transformation von Strukturen und Haltungen. Allzu oft muss die Frage gestellt werden: Sind die Bemühungen „Lippenbekenntnisse oder wirkliche Praxis?“
Dabei ist klar: Die Forderung einer „Entwicklung“ des Globalen Südens nach westlichem Vorbild würde nicht nur in kolonialen Denkmustern verharren, sondern hätte auch verheerende Auswirkungen auf unseren Planeten: Wenn alle Menschen der Welt leben würden wie in Deutschland, wäre in diesem Jahr am 4. Mai der Erdüberlastungstag erreicht. Das bedeutet, dass an diesem Tag alle Ressourcen verbraucht wären, die der Weltbevölkerung für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen.
Wir müssen „Entwicklung“ also neu denken, alternative Ansätze zulassen und dem Widerstand gegen Kolonialismus und seinen Folgen Aufmerksamkeit schenken: Das aktuell viel über Dekolonisierung diskutiert wird ist dabei insbesondere dem langjährigen Aktivismus durch Betroffene und den Selbstorganisationen Schwarzer Menschen zu verdanken. Mit Blick auf deren Arbeiten sowie den VENRO-Report wird klar, dass Dekolonisierung überall ansetzen muss: Im Globalen Norden wie im Süden, in bürokratischen Prozessen der Bundesministerien in Berlin wie in der „Eine Welt-Arbeit“ vor Ort.
Dazu brauch es - neben vielem Anderen - Selbstkritik und Demut. Diesem Thema ist eine der Skulpturen gewidmet, die im Rahmen des Projekts „Sustainable Jetzt“ des EPIZ entstanden ist. Sie wird mit vielen weiteren bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim (LAGA) zu sehen sein, welche am 14. April ihre Tore öffnet.
Einen erkenntnisreichen April, vielleicht mit einem Besuch auf der LAGA, wünschen
Annika Bucher und das EPIZ-Team
März 2023: Freiwilliges Engagement weltweit: Gut gemeint ≠ gut gemacht!?
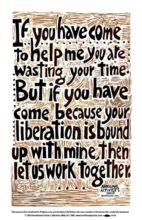
„Wenn du gekommen bist, um mir zu helfen, verschwendest du deine Zeit, aber wenn du gekommen bist, weil deine Befreiung mit meiner verbunden ist, dann lass uns zusammenarbeiten.“ So beschrieb in den 1970ern eine Gruppe Indigener in Australien ihr Unwohlsein mit dem Konzept „Helfen“.
Aber warum kann das Engagieren für Schwächere, Benachteiligte oder Leidende problematisch sein? Erst recht, wenn Menschen dafür viel Aufwand betreiben? Jedes Jahr reisen beispielsweise über das weltwärts-Programm 3.500 junge Freiwillige aus Deutschland in den Globalen Süden. Für ein Jahr arbeiten sie in emeinnützigen Organisationen wie ländlichen Schulen oder Kinderheimen – und das meist mit viel persönlichem Einsatz und bewundernswertem Idealismus.
Viele erfahrene Beteiligte zweifeln jedoch gemeinsam mit zahlreichen Wissenschaftler*innen wie Benjamin Haas oder Dr. Kristina Kontzi an der weit erbreiteten Überzeugung, dass „Helfen“ als Freiwillige im Globalen Süden stets unbedenklich ist: Die Kritik bezieht sich dabei meist auf das Problem der unterschiedlichen Machtverteilung: Egal, wie sehr sich insbesondere weiße Freiwillige auch bemühen: Eine als gleichberechtigt wahrgenommene Begegnung im Globalen Süden erzählt in fast allen Fällen „das Märchen von der Augenhöhe“. In der Broschüre „Wer anderen einen Brunnen gräbt“ werden zentrale Fragen aufgeworfen: Wer hat Zugang zu Freiwilligendiensten? Wer fühlt sich angesprochen? Wer ist in der Position zu „helfen“? Und welche kolonialen Kontinuitäten gibt es? Der ASC Göttingen verweist treffend darauf, dass „weltwärts ein Lerndienst für junge Menschen ist. [...] Wer sich als europäische*r Retter*in hinaus in die Welt gezogen fühlt, ist hier fehl am Platz. weltwärts bietet vielmehr die Chance [...] eine neue Perspektive auf das Leben zu erfahren. Mit diesem neugewonnenen Verständnis kann eine neue Achtung vor Vielfalt entstehen.“ Eindrücklich illustrieren dies die kurzen, humorvollen Videoclips der Initiative
„RADI-AID“: Dort werden Stereotype über Afrika ad-absurdum geführt, in einer Quizshow eine Volunteer-Gewinnerin gekürt und im Kampagnenclip „Africa for
Norway“ werden diskriminierende Charity-Songs verspottet.
Diese und viele weitere Perspektiven auf internationale Freiwilligendienste – u.a. von glokal, den Zugvögeln, Brückenwind und Global Match - präsentieren das EPIZ und Mitstreiter*innen im Rahmen des in Göttingen stattfindenden Jubiläumsfestivals von weltwärts am 1. und 2. Juni am Jahnstadion. Es geht dabei nicht darum, die Einsätze von Freiwilligen zu verdammen, sondern sie inklusiver, machtkritischer und wirkungsvoller zu machen – wie es u.a. ein aktuelles Rahmenpapier vorschlägt: Hin zu einer „weltweiten Bewegung von Freiwilligen, die sich effektiv für eine Welt einsetzen, in der niemand zurückgelassen wird.“ (International Forum for Volunteering in Development)
Einen verbindenden März wünschen Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Februar 2023: Gemeinwohlorientiert, empathisch, global solidarisch: Das südniedersächsische „Pluriversum“ wächst und gedeiht

„In die Welt, die wir wollen, passt jede*r. In die Welt, die wir wollen, passen viele Welten.“ - So wie die Zapatist*innen setzen sich viele für eine „pluralistische, tolerante, integrative, demokratische, gerechte, freie und neue Gesellschaft“ (4. Declaration of the Lacandona Jungle) weltweit ein.
Dazu gehören auch die Gastgebenden einer zapatistischen Delegation in Göttingen im vergangenen Jahr: Unter Anderem beim Roten Buchladen, dem Klimacamp, im JuZi und in der OM10 wurden Visionen für ein Gutes Leben für alle diskutiert. Das diese inspirierenden Zukunftserzählungen nötig sind, zeigt sich immer wieder: Besonders eindrucksvoll beschreiben es zahlreiche Wissenschaftler*innen, welche die Welt in einer Polykrise (Mehrfachkrise) sehen.
Ähnlich sehen es auch die Herausgeber*innen des Buches „Pluriverse“: Aus ihrer Sicht braucht es einen grundlegenden kulturellen Wandel hin zu empathischen Beziehungen zwischen Menschen und Gesellschaften sowie Lebensweisen, die im Einklang mit der Natur stehen. Dafür stehen auch die Anhänger*innen von Philosophien wie dem Ubuntu aus Südafrika oder dem Swaraj aus Indien. Generell gilt bei Unterstützer*innen der populärer werdenden wissenschaftlichen Denkschule „Post-Development“: Es braucht keine alternative Entwicklung, sondern Alternativen zu Entwicklung. Dazu gehört die Zuwendung zu nichtwestlichen Werten, Perspektiven und Praktiken.
Auf dem Weg dorthin müssen wir, wie Prof. Evan Barba unterstreicht, Selbstreflexion betreiben. Dazu zählt, dass wir uns um eine Kritik- und Feedbackkultur bemühen und erforschen, mit welchen „Brillen“ wir auf die Welt schauen. So können wir Voreingenommenheiten aufdecken, diese „auspacken“ und an Veränderungen arbeiten sowie Designer*innen für Transformation werden.
Auf derlei Reisen haben sich auch in Südniedersachsen schon zahlreiche Einzelpersonen, aber auch Gruppen und Initiativen gemacht. Wer dazu zählen könnte, wollen wir gemeinsam herausfinden: Beim Workshop zum Pluriversum im April sind alle herzlich willkommen, die sich mit uns auf die Suche nach Wegen hin zu ökologischeren, gerechteren und sozialeren Welten machen möchten.
Um bis dahin nicht in der Theorie zu bleiben, sondern praktisch Kulturwandel anzustoßen, singen wir mit Judith Holofernes in der heimischen Hängematte: „Danke, ich hab schon genug genug genug!“
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
Januar 2023: Jin, Jiyan, Azadî! – Im Iran, in Rojava und darüber hinaus

Am 16.09.2022 wurde die kurdische Iranerin Jîna Amīnī von der Sittenpolizei festgenommen und starb später an den Folgen von Polizeigewalt. Dies löste eine weltweite Protestwelle aus, an der sich auch viele Menschen in Göttingen beteiligen. Der begleitende Slogan „Jin, Jiyan, Azadî“ (Frau, Leben, Freiheit) erhält seitdem weltweit Aufmerksamkeit. Er kommt aus der kurdischen Frauenbewegung und ist eng verknüpft mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Sie kämpft für Kurd*innen, Assyrer*innen, Aramär*innen und Yezid*innen gegen Kriege, Ausbeutungen und Verfolgungen durch die Regierungen Irans, Iraks, der Türkei und Syriens.
2023 jährt sich die Unterzeichnung des Vertrags von Lausanne zum hundertsten Mal, welcher die Spaltung des kurdischen Siedlungsgebiets besiegelte. Der anti-kurdische Rassismus brachte jedoch auch eine Freiheitsbewegung hervor, die während des Arabischen Frühlings zu einer Revolution führte: Das neue Gesellschaftsmodell, unter Anderem praktiziert in der Region Rojava, beruht auf den Prinzipen der Frauenbefreiung, des Pluralismus, direkter Basisdemokratie und Ökologie. Dagegen führt die Türkei seit Jahren einen völkerrechtswidrigen Krieg (wie auch der Bundestag bestätigt), der sich aktuell wieder zuspitzt: Zahlreichen Berichten nach gibt es Hinweise auf den Einsatz chemischer Waffen. Insbesondere führt die Türkei auch wieder einen Angriffskrieg auf Rojava: Dieser wird von türkischer Seite als Antwort auf ein Attentat in Istanbul am 13.11. dargestellt, für das schon kurz nach dem Anschlag die PKK verantwortlich gemacht wurde. Diese distanzierte sich jedoch sehr schnell vom Anschlag und die FAZ bezeichnet die Schuldzuweisung als seltsam.
Wir fragen uns: Warum verurteilen wir den Krieg Russlands, kaum aber den der Türkei? Bevor Deutschland sich mit einer feministischen Außenpolitik schmücken kann, muss die Regierung auf die Einhaltung des Völkerrechts pochen. Sie muss sich gegen die Angriffe des NATO-Partners sowie die Rüstungsexporte dorthin stellen und für eine friedliche Lösung der kurdischen Fragen eintreten. Dabei haben auch wir als Zivilgesellschaft die Verantwortung, die Zusammenhänge zwischen derlei autoritären Regimen und der EU sowie der NATO zu ergründen. Solidarität heißt hier: Lokale, nationale und globale Kämpfe zusammen zu denken und miteinander zu verbinden.
Auch in Südniedersachen gibt es einige Gruppen und Initiativen, die das tun: Die in Göttingen ansässige Gesellschaft für bedrohte Völker setzt sich für die Aufhebung des PKK-Verbots ein, an dem seit 2018 auch ein EU-Gericht Zweifel hat. Außerdem engagiert sich das FlüchtlingsCafé Göttingen zusammen mit weiteren Gruppen rund um das Hausprojekt OM10 für transnationale Solidarität. In Anbetracht der komplexen globalen Verstrickungen erhoffen und erarbeiten wir uns ein zuversichtliches Jahr 2023: Bei uns, im Iran, in Kurdistan und überall: Jin, Jiyan, Azadî!
Sophie Paulmann und das EPIZ-Team
Dezember 2022: Zu den Wurzeln unserer Bedürfnisse – in Südniedersachsen und überall
Schon oft haben wir von weniger Konsum, mehr teilen, mehr reparieren, mehr lokale Bedürfnisbefriedigung, „Degrowth“ und so weiter gehört, gelesen, philosophiert. Doch der diesjährige Dezember verdeutlicht einmal mehr systemische Widersprüche: Bei stark steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen wirkt der weihnachtliche Fokus auf Konsum erst recht Fehl am Platz.
„Ein Milliardär ist so klimaschädlich wie eine Million Menschen“ – so die letzte Oxfam-Studie. Sie verdeutlicht, dass wir politische Lösungen brauchen. Gleichzeitig müssen wir konsumorientierte Lebensstile, insbesondere von uns wohlhabenden Menschen im Globalen Norden, grundlegend in Frage stellen: Es gibt nachhaltigere Wege zur Bedürfnisbefriedigung als solche, die mit Flugreisen, SUVs und Luxusvillen zusammen hängen.
Dem schließt sich auch die Seebrücke-Bewegung an, die in ihrem letzten Newsletter schreibt: „Gerade in angespannten Zeiten sind kleine Gesten von Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung […] viel wichtiger als die groß inszenierten Rabattschlachten in den Läden und den Onlineshops am Ende des Jahres.“ Das passt in den Zeitgeist: Laut dem „Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution“, verfasst vom in Göttingen habilitierten Prof. Klaus Dörre, braucht es eine deutlich veränderte Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur, die feministische, ökologische und indigene Ansätze miteinbezieht. Dem pflichtet auch die Transformationsforscherin Maja Göpel bei. Sie unterstreicht, dass wir ran müssen an die Wurzeln der Probleme: Dazu sollten wir die uns umgebenden Systeme ganzheitlich betrachten, denn „wir können auch anders.“ Sie schlägt vor, uns wieder mehr mit der Frage zu beschäftigen: Was macht uns und andere wirklich glücklich?
Alles, außer lieblose Geschenke! Besuche!? Zeit füreinander!? Zuwendung!? Inspirationen gibt es bei Oxfam’s „Geschenke, die Gutes tun“ und die Seebrücke (von der es tolle Gruppen in Einbeck, Göttingen, Holzminden und im Harz gibt) empfiehlt „Spende statt Geschenke“.
Warum? Darum: „So düster die drohende Gefahr einer Klimakatastrophe über uns schwebt, so hell kann die Freude darüber strahlen, dieser Prognose zu trotzen und eine Zukunft zu schaffen, in der die Menschheit wieder atmen, sicher sein, leben kann. Diese Freude, die Lust auf Veränderung, auf das Bauen einer neuen Gesellschaft [wird] angetrieben von all jenen, die eine Idee haben, wo entlang wir gehen müssen.“ (Institut Solidarische Moderne)
Werden wir Teil des Wandels oder verstärken wir angesichts der multiplen Krisen unser Engagement!
Chris Herrwig und das EPIZ-Team
November 2022: Um wen geht es? Schauen wir in den Spiegel!

Menschenrechtsverletzungen in Katar, steigender CO2-Ausstoss in Indien und China, Wahlsiege von (Post-)Faschist*innen in Italien und Schweden: Es fällt leicht Probleme nicht bei uns zu suchen. Doch eine kleine Übung verdeutlicht, dass der Fokus auf „Andere“ viel über uns selbst aussagt: Während wir mit dem Zeigefinger auf Andere deuten sind drei Finger auf uns gerichtet.
„Externalisierung“ nennt die Wissenschaft dieses Phänomen: Die Verantwortung wird nicht bei sich selbst, sondern außerhalb der eigenen Einflusssphäre gesucht. Eine prima Strategie, um die eigene Verwicklung zu verstecken und sich keine Gedanken über mögliche Handlungsmöglichkeiten machen zu müssen. Es ist bequem sich lustig zu machen über Franz Beckenbauer, der auf den WM-Baustellen „keinen einzigen Sklaven gesehen hat.“ Oder über Uli Hoeneß, der auf Kritik reagierte mit: „Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International!“
Nur: Denken wir beim Tanken mit Öl aus Katar an die Berichte diverser Menschenrechtsorgas und verkneifen uns das Fahren? Erinnern wir uns an die Reportagen zahlreicher Journalist*innen zu den vielen Todesfällen während wir uns die WM-Spiele anschauen, die in den dafür verantwortlichen Stadien ausgetragen werden? Schalten wir ab? Schreiben wir Protestbriefe an die Verantwortlichen?
„Kognitive Dissonanz“ führt zu oftmals großen Lücken: Zwischen unserm Wissen darum, was gut und richtig für mich, meine Mitmenschen und die Umwelt wäre und meinen realen Verhaltensweisen. Dank unserer globalisierten und komplexen Welt verstecken sich die Folgen unseres Handeln meist recht gut, da sie an entfernten Orten auftreten, zeitlich erst viel später sichtbar werden (wie beim Klimawandel) oder Wirkungen kaum exakt zu meinen Aktivitäten zuzuordnen sind. So lebt es sich leicht mit der Textzeile von Dota Kehr im Ohr: „Immer die Ander'n - wie könnt' es anders sein.“
Wir sind da ganz bei der Band „Die Ärzte“: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär’ nur deine Schuld wenn sie so bleibt!“ - Dem würde wohl auch der Göttinger Menschenrechtler Dr. Kamal Sido zustimmen. Er verweist auf die „vielen Gegenangebote an Veranstaltungen, wo sich kritisch mit der WM auseinandergesetzt werden kann.“ Dabei sind auch viele Bars und Kneipen, die statt Public Viewing andere Aktivitäten ins Programm nehmen. Auf der WM-Boykott-Karte des Katapult-Magazins findet sich aus der Region nur der Clausthaler „Kellerclub im Stuz“. Dort gibt es, wie bei vielen anderen Kneipen deutschlandweit auch, „Quartett statt Katar.“
Wie in den Toiletten der Kneipen hängt aktuell auch auf dem Gelände des Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen in Duderstadt ein Spiegel. Dieser ist Teil der EPIZ-Lernskulpturen und ist beschriftet mit: „Hier siehst Du den Menschen, der die Welt verändern kann“.
In diesem Sinne: Einen selbstreflektierten November wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
Oktober 2022: Solidarisch Kritik geben und nehmen in Südniedersachsen und überall

„Sie hat mich ganz höflich darauf hingewiesen, dass sie das Wort als Betroffene für ein Problem hält und sich davon verletzt fühlt.“ So beschreibt eine Apothekerin aus Hofgeismar (westlich von Göttingen), warum sie den problematischen Namen ihres Ladens änderte und unterstreicht: „Viele gesellschaftliche Probleme kann ich persönlich nicht lösen. Doch hier kann ich aktiv etwas verändern.“
Wie sie sind auch die meisten Wissenschaftler*innen überzeugt, dass Sprache einen immensen Einfluss hat. „Sprache ist eine mächtige Lenkerin, die Denken, Empfinden und Werten [...] vorprägt“ schreibt Prof. Josef Klein. Wenig überraschend bildet unser Sprachgebrauch so auch historisch-gewachsene Machtungleichheiten ab. Dies zeigen sehr eindrucksvoll Prof. Susan Arndt sowie die Journalistin Nadja Ofuatey-Alazard in ihrem Buch „(K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache“ – das steht natürlich auch in unserer gut sortierten EPIZ-Bibliothek zur Ausleihe.
Dort, wie an vielen anderen Stellen, wird auch auf die Problematik des Begriffs „Entwicklung“ verwiesen: Das westlich-geprägte Konzept und die meist damit verbundenen Vorstellungen von „Modernisierung“ sind bis heute eng verknüpft mit kolonialen Kontinuitäten und den damit einhergehenden Machtasymmetrien. Dabei sind wir uns doch heute fast alle einig, dass wir mit Blick auf globale Ungleichheiten viel mehr verwickelt als entwickelt sind. Damit rücken eher Begriffe wie Solidarität und das gemeinsame Streben nach (globaler) Gerechtigkeit in den Vordergrund.
Hier knüpfen auch aktuelle Debatten innerhalb des Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen an: Auf der kommenden für alle offenen Landeskonferenz „geht es um ganz Grundsätzliches: Ist die aktuelle Entwicklungspolitik noch angemessen in Zeiten der vielfachen weltweiten Krisen? Ist „Entwicklung“ noch das richtige Konzept angesichts dekolonialer Kritik? Und wie ist es möglich, sich für eine gerechte, friedliche und nachhaltige Welt zu engagieren?“
Vielleicht findet sich das „Gute Leben“ eher beim entspannten Genuss eines Einbecker Bieres in netter Gesellschaft am Wendebach-Stausee als auf einer Yacht vor den Bahamas? Vielleicht ist uns die Ermöglichung eines Lebens in Würde für alle Lebewesen weltweit wichtiger als das Privileg auf Kosten anderer und der Natur zu leben? So wie die „Apotheke mit Herz“ nicht verletzt sondern heilt und die deutsche Band „Electric Callboy“ nicht nur ihren problematischen Namen änderte, sondern den begleitenden Prozess zusammen mit ihren Fans (selbst-)kritisch reflektiert.
In diesem Sinne: Einen elektrisierenden Oktober „mit Herz“ wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
September 2022: Südniedersachsen - Eine Welt, in der viele Welten Platz haben!?

„Das Leben in all seiner Fülle ausschöpfen, den Kontakt zur Natur suchen, sie zu verstehen und mit ihr in Harmonie zu leben. Essen im Überfluß, ein Dach überm Kopf und keine Sorgen zu haben.“ - Klingt erstrebenswert, oder? Mit diesen Worten beschreibt Patricia Gualinga, Sprecherin der Gemeinschaft von Sarayaku aus dem Amazonasgebiet für den Deutschlandfunk das „Sumak Kawsay“ (Gutes Leben).
Ähnlich klingt es bei vergleichbaren (indigenen) Philosophien wie dem „Ubuntu“ der Zulu und Xhosa im südlichen Afrika, dem „Pachamama“ der Quechua und Aymara in den Anden, dem „Sankofa“ der Akan im westlichen Afrika, dem Demokratischen Konföderalismus der kurdischen Bewegung in Rojava und Co, dem „Kawaida“ des Black Freedom Movements oder dem „Zapatismo“ in Mexiko.
Im Angesicht der zahlreichen multiplen Krisen (Klima, Umwelt, globale Gerechtigkeit…) wird immer deutlicher, dass sich unsere Gesellschaften grundlegend verändern müssen. Starke Stimmen finden sich dafür zuhauf. Eine kommt von Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt und diese war auch auf dem vergangenen Weltweitwissen-Leitkongress für Globales Lernen deutlich vernehmbar: Wir brauchen dauerhafte und global durchhaltbare Lebens- und Wirtschaftsweisen. Von denen sind wir aktuell im Bezug auf die wichtigsten Felder Energie, Klima, Ressourcen oder Ökosysteme meilenweit entfernt.
Es braucht demnach tiefgreifende und nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen. Dafür sind insbesondere unsere Haltungen und Lebensweisen verantwortlich. Um diese zu reflektieren und zu transformieren müssen wir allerdings nicht (nur) in den Globalen Süden schauen: Auch bei uns gibt es zarte Pflänzchen für sozial-ökologischen Kulturwandel: Sei es beispielsweise der „Utopische Freiraum K20“ in Einbeck, die (subkulturellen) Göttinger Vereine „Flause“ und „Peloton“, das freie Theater „boat people project“, die migrantisch-geprägten „Internationalen Gärten“ sowie die Zukunfts-Werkstatt im Haus der Kulturen, die Organisator*innen des „African Liberation Day“ und das „BIPoC-Kollektiv“ in Göttingen oder der Lebens- und Lernort „gASTWERKe“ im Süden des Landkreises.
Es gibt sie also auch bei uns: Eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Wenn es nach uns geht, darf dieses südniedersächsische „Pluriverse“ gerne noch größer und vielfältiger werden.
In diesem Sinne: Einen bunten September – nicht nur Dank des einsetzenden Herbstes - wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
Juli/August 2022: Wir fragen uns, was ist „fair“? In Südniedersachsen und überall
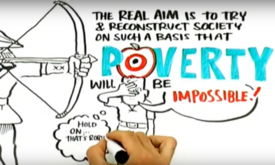
Wie schön wäre es, wenn „Fairer Handel“ uns endlich globale Gerechtigkeit bringen würde. Wie gerne würden wir tagtäglich im wunderbaren Göttinger Weltladencafé oder einem der vielen verwandten Läden im Umland einkaufen und uns ansonsten nicht mit Armut, Hunger und Ausbeutung weltweit beschäftigen zu müssen. Laut einer Studie des Forum Fairer Handel gab jede vierte befragte Person an, regelmäßig fair gehandelte Produkte zu kaufen – das sind doch gute Nachrichten, oder?
Viele haben Zweifel, auch der Philosoph Slavoj Žižek. Er verweist in einem sehr empfehlenswerten Beitrag auf problematische Dynamiken. Dazu zählt, dass unreflektierter und unkritischer „ethischer“ Konsum das ausbeuterische System eher stützt: Er kann dazu beitragen einigen Produzent*innen ein besseres Auskommen zu ermöglichen. Dadurch verhindert er aber eventuell die Umstrukturierung globaler Handelsbeziehungen als Ganzes. Drastisch formuliert Žižek angelehnt an Oscar Wilde: „Die schlimmsten Sklavenhalter*innen sind diejenigen, die nett zu ihren Sklav*innen sind.“
Das Unternehmen „fairafric“ wirbt damit, dass die Produktion der Schokolade nicht wie üblich in Europa, sondern in Ghana stattfindet. Damit bleibt ein größerer Teil der Wertschöpfung als üblich im Ursprungsland – jedoch weiterhin weniger als die Hälfte. Wir und andere fragen uns: Ist dafür die Bezeichnung „superfair“ gerechtfertigt, die das Unternehmen auf die Schokoladen druckt?
Der Begriff „fair“ ist nicht geschützt, worauf die Guerilla Aktion „Agraprofit“ schon 2012 eindrucksvoll hinwies – mit einem Marktstand der Spottpreise anbot, die fair waren - für die Konsument*innen.
Um breiten- und tiefenwirksam zu sein muss der Faire Handel flankiert werden von Kampagnenarbeit, wie sie neben den Weltläden beispielsweise die Initiative Lieferkettengesetz betreibt: Sie kämpft für eine EU-weite Regelung von Arbeits- und Produktionsbedingungen. Andere, wie die Vereine „Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung“ oder „Germanwatch“ setzen zusätzlich auf transformative Bildungsarbeit, Informationsveranstaltungen und politische Lobbyarbeit.
Davon lassen wir uns gerne inspirieren: Während wir im anstehenden Sommer das vorzügliche „Fair CoCo“-Eis in der Göttinger Nikolaistraße schlemmen oder auch andere faire Produkte aus dem EPIZ-Einkaufsführer „Gö Fair“, wollen wir gerne noch mehr Reflexionsgespräche über die Transformation des globalen Handelsregimes führen. Sicherlich auch eine prima Vorbereitung auf die Faire Woche, die im September auch wieder in Göttingen und Umgebung das Thema Fairer Handel sprichwörtlich in alle Munde bringen will. Beiträge zum Veranstaltungsprogramm können übrigens noch bis zum 17. Juli eingereicht werden :)
Einen guten – nein, einen superguten! - Sommer wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
Juni 2022: Es ist mehr als genug Nahrung für alle da – in Südniedersachsen und überall

Im Hintergrund läuft elektronische Musik, im Vordergrund schnippeln zahlreiche junge und nicht mehr ganz junge Menschen gerettete Lebensmittel und gesprochen wird unter Anderem über Ernährungssouveränität und Land Grabbing: An vielen Orten finden immer wieder sogenannte Schnippeldiskos statt, auch in Göttingen beim Westfest auf dem Peloton Gelände an der musa.
Vielen hier ist bewusst, dass etwa ein Zehntel der fast acht Milliarden Menschen weltweit hungert, trotz verfügbarer Nahrung für ca. zehn bis zwölf Milliarden. Die Nahrungsmittelverteilung heute unterscheidet sich kaum von der aus der Kolonialzeit: Besonders aus dem Globalen Süden werden Rohstoffe exportiert und im Norden zu Geld gemacht.
Nicht zuletzt auch im „Fleischland Niedersachsen“, wo wertvolle Nahrung tagtäglich an etwa 2,5 Millionen Rinder, 8 Millionen Schweine und knapp 86 Millionen Hühner verfüttert wird. Vieles davon kommt aus dem Globalen Süden über Europas führenden Importhafen für Futtermittel in Brake an der Weser hierher.
Gegen dieses Ernährungsregime regt sich Widerstand: Wie viele andere auch fordert die Slow Food Youth mit ihrem Göttinger Ableger faire Wertschöpfungsketten im Rahmen der Kampagne #OurFoodOurFuture. Ähnlich positioniert sich der Ernährungsrat Göttingen für Soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und Krisenbeständigkeit. Kleinbäuer*innen brauchen Zugang zu Land, Wasser und Saatgut sowie machtsensible Handelsabkommen und eine gerechte Förderpolitik – wie vom International Peasants’ Movement La Via Campesina oder auch der Nyéléni-Bewegung für Ernährungssouveränität gefordert.
Über solche Ansätze lässt sich vortrefflich in öffentlichen Gemeinschaftsgärten diskutieren, zum Beispiel in den Internationalen Gärten in Göttingen. Während hier im Hintergrund Bienen summen und im Vordergrund Menschen mit vielfältigen Identitäten zusammen Obst und Gemüse pflanzen wird deutlich: Ein sozial-ökologisches Ernährungssystem ist möglich.
Einen satten und geschmackvollen Juni wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
Mai 2022: Eine globalisierte Welt braucht vielfältige und machtkritische Geschichte(n) – in Südniedersachsen und überall

Zahlreiche rot-schwarz-grüne Fahnen der Bewegung eines freien und vereinten Afrikas werden geschwenkt, von Transparenten grüßt der Freiheitskämpfer T homas Sankara und in Redebeiträgen wird Imperialismus angeprangert: Das geschieht nicht nur in Bamako/Mali, Accra/Ghana oder Lagos/Nigeria sondern in Göttingen im Mai 2021. Anlässlich des African Liberation Days zogen 200 Menschen durch die Innenstadt. Sie zeigten eindrucksvoll: Südniedersachsen ist mehr als die Gebrüder Grimm, Bismarck oder Johann Carl Friedrich Gauß.
Dennoch bekommen Geschichten wie die von Dr. Chicgoua Noubactep, dem in Kamerun geborenen langjährigen Ortsbürgermeister von Rittmarshausen im Landkreis Göttingen (bis 2021), aufgrund von bestehenden Machtstrukturen viel zu selten Raum. Darauf weist unter Anderem die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrem millionenfach geklickten Beitrag „The danger of a single story“ hin. Neben ihr stellen viele andere, wie beispielsweise die Neuen deutschen Medienmacher*innen, die entscheidenden Fragen: Welche Geschichten werden erzählt? Wer erzählt? Wer wird gehört?
„BBQ – Der Black Brown Queere Podcast“ findet darauf klare Antworten: Hier
liefern der in Göttingen aufgewachsene Dominik Djialeu und sein Co-Host Zuher Jazmati queere und BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) Perspektiven auf Themen mit gesellschaftlicher Relevanz. Solche spiegeln sich auch im Film „Futur Drei“, in der sich eine postmigrantische Pop-Utopie (Zitat Spiegel) entfaltet. Dank der Schauspielerin Florence Kasumba ist inzwischen auch eine afrodeutsche Ermittlerin im Göttinger Tatort präsent.
Ähnlich steht es um den ersten schwarzen Superhelden im US-amerikanischen Comic-Mainstream: Dessen oscarprämierte Verfilmung „Black Panther“, bei der auch Florence Kasumba mitwirkte, thematisiert unter anderem die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen auf dem afrikanischen Kontinent und die Frage nach globaler Solidarität mit Schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen.
Mit diesen Themen beschäftigen sich in Göttingen intensiv das BIPoC-Kollektiv sowie die lokalen Organisator*innen des bereits oben erwähnten African Liberation Day – der auch in diesem Jahr wieder weltweit und auch in Südniedersachsen am 25. Mai begangen wird. Vorher - am 10. Mai – veröffentlicht außerdem die Vernetzung „Göttingen Postkolonial“ ihren neuen Stadtrundgang.
Einen Mai voller machtkritischer und diskriminierungssensibler Reflexionen wünschen
Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
April 2022: #StandWithUkraine und #leavenoonebehind

„Wir können nichts tun ohne Optimismus“ schreibt die Bürgerrechtlerin Angela Davis mit Blick auf Anti-Kriegs-Proteste. In diesem Sinne fragen wir uns gemeinsam mit unserm Dachverband VENRO: Wie kann eine angemessene Haltung zur humanitären Katastrophe in Europa aussehen?
Das Leid in der Ukraine bewegt uns sehr. Gleichzeitig gehen unsere Gedanken auch nach Tigray/Äthiopien, in den Jemen, den Kongo, nach Mali, Sudan und Südsudan, Syrien, Kurdistan und nach Afghanistan. In vielen Teilen der Welt finden blutige Konflikte statt. Bei fast allen sind auch europäische Akteur*innen beteiligt und europäische Firmen verdienen mit. Darauf weist das transnationale Netzwerk Afrique Europe-Interact (AEI) hin.
Mit dem in Göttingen ansässigen Roma Center und vielen anderen Organisationen kritisiert AEI auch in diesem Zusammenhang die rassistische Ungleichbehandlung von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen und in der medialen Wahrnehmung: Viele Berichte verweisen auf rassistische Diskurse rund um zivilisierte und unzivilisierte Kriegsopfer.
Dabei ist Krieg mit Abstand die größte Fluchtursache, egal ob in Kiew, Bamako oder Mek’ele. Darauf verweist auch das südniedersächsische Museum Friedland. Jeder Krieg bringt unsägliche Folgen mit sich, unter Anderem anschließende Nahrungsmittelknappheit: Auf Krieg folgt Hunger. Dies wird jetzt besonders befürchtet, da Russland und die Ukraine große Getreideexporteur*innen sind. Von den Lieferungen abhängig sind insbesondere materiell arme Gebiete in Afrika und Asien, wie der kriegsgebeutelte Jemen oder der Libanon.
Sanktionen sollten die Machthabenden treffen. Menschen auf der Flucht brauchen unsere direkte Unterstützung. Als lokale Koordinierungsstelle fungiert dafür unter Anderem das Migrationszentrum in Göttingen. Spenden und praktische Hilfe wie Übernachtungsplätze vermitteln zahlreiche Organisationen der Region, unter Anderem „Rock for Tolerance e.V.“ in Hannoversch Münden.
Die breite Solidarität vermittelt – ganz im Sinne von Angela Davis – Optimismus und die Hoffnung auf bessere Zeiten. Daher summen wir dann doch mit den Musikern Kummer und Fred Rabe „Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut“.
Einen optimistischen April wünschen Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
März 2022: Fallen und Fliegen im sich wandelnden Südniedersachsen

Fallen, schreibt der Philosoph Báyò Akómoláfé, könnte sehr gut auch fliegen sein – wenn wir nur die Koordinaten „oben“/“unten“ loswerden und uns freier im Raum bewegen: Das Fehlen von Koordinaten, von klaren Zielen und Gewissheiten, nehmen wir viel zu oft als Problem wahr. Wir tendieren dazu, Ungewissheiten und Widersprüche kaum aushalten zu können. Dabei müssten wir nicht darüber stolpern. Statt zu taumeln und zu fallen könnten wir – fliegen.
Dazu bräuchte es einen radikalen Kulturwandel: Einlassen aufs Treiben lassen, auf unplanbare Wege und auf Pfade, die bisher kaum erforscht und kaum beschritten wurden. Einlassen auf radikale Brüche mit unseren heutigen imperialen Lebensstilen, wie sie die Wissenschaftler Ulrich Brand und Markus Wissen beschreiben. Wie viele andere weisen sie darauf hin, dass wir nicht um eine „sozial-ökologische Transformation“ herumkommen werden – hin zu einer solidarischen Lebensweise.
Dabei unterstützen kann uns das Lernen, die Welt aus vielen Perspektiven „lesen“ zu können: Wie wir Dinge wahrnehmen und welche Annahmen dahinter stecken, ist uns viel zu selten bewusst. So entgehen uns beispielsweise indigene Wissensschätze – was nicht zuletzt an der fehlenden Aufarbeitung kolonialer Kontinuitäten liegt.
Ein Schritt dahin wurde am 9. Februar 2022 vollzogen: An diesem Tag übergab die Universität Göttingen menschliche Überreste aus ihren Sammlungen an hawaiianische Nachfahren – so wie auch Institutionen in Bremen, Jena, Berlin und Wien. 58 iwi kūpuna - wie die Gebeine der Ahnen in Hawaii genannt werden - kehren so wieder zurück in ihre Heimat. Diese sogenannten Restitutionen lassen mindestens Anklänge eines Kulturwandels erahnen.
Derlei dekoloniale Momente finden viel zu selten den Weg auf die großen Titelseiten. Gut, dass es aber Journalist*innen wie Sham Jaff und ihren Newsletter „What happened last week“ gibt: In diesem finden marginalisierte Stimmen weltweit Gehör. Wer dazu noch die passende Musik braucht, der sei auf die dazugehörige Playlist „Decolonize Weekly“ hingewiesen :)
Zu deren Klängen lässt es sich vortrefflich fliegen – ohne die hinderlichen Zwänge von Koordinaten, die uns in weitere multiple Krisen leiten anstatt in die Richtung des Guten Lebens für Alle.
Einen guten Frühlingsstart wünschen Chris Herrwig und das EPIZ-Team!
